Nicht lieferbar
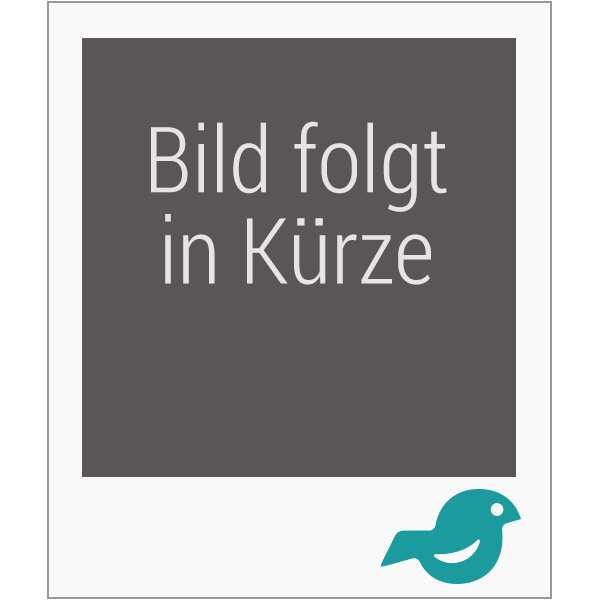
Italo Svevo
Broschiertes Buch
Die Novelle vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Die Novelle vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen
Produktdetails
- rororo Taschenbücher
- Verlag: Rowohlt TB.
- Gewicht: 92g
- ISBN-13: 9783499136443
- ISBN-10: 3499136449
- Artikelnr.: 05776524
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.03.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.03.2003Der alte Mann und das Mädchen
Musen bleiben ewig jung: Wie die Altersliebe in der Literatur vom Komödienstoff zur Allegorie der Leistungsgesellschaft wurde / Von Hannelore Schlaffer
Der Rat ist gut gemeint: "Man sollte nach Verhältnis immer frein, / Da Jugend sich und Alter oft entzwein."
Die "Canterbury Tales", in denen Chaucer den alten Männern diese Ermahnung erteilt, werden nicht etwa deshalb weniger gelesen, weil die Leselust abnimmt, sondern weil ihre Weisheit nicht mehr gilt. Heute herrscht ein der alten Lehre genau entgegenstehendes Gesetz: Ein Mann ist so bedeutend, wie der Altersunterschied zwischen ihm und seiner Frau oder Freundin groß ist. Die Künstler sind die Stilbildner der bürgerlichen
Musen bleiben ewig jung: Wie die Altersliebe in der Literatur vom Komödienstoff zur Allegorie der Leistungsgesellschaft wurde / Von Hannelore Schlaffer
Der Rat ist gut gemeint: "Man sollte nach Verhältnis immer frein, / Da Jugend sich und Alter oft entzwein."
Die "Canterbury Tales", in denen Chaucer den alten Männern diese Ermahnung erteilt, werden nicht etwa deshalb weniger gelesen, weil die Leselust abnimmt, sondern weil ihre Weisheit nicht mehr gilt. Heute herrscht ein der alten Lehre genau entgegenstehendes Gesetz: Ein Mann ist so bedeutend, wie der Altersunterschied zwischen ihm und seiner Frau oder Freundin groß ist. Die Künstler sind die Stilbildner der bürgerlichen
Mehr anzeigen
Gesellschaft. Sie zuerst haben die immer neue und immer jüngere Frau als lebensnotwendigen Epochenwandel in ihrem Schaffen ausgegeben.
Casals war fünfundsiebzig Jahre alt, als er 1951 Marita Montañez kennenlernte, sie war vierzehn. Drei Jahre später wurde sie seine Schülerin, 1957 heiratete der Cellist die um einundsechzig Jahre Jüngere. Picasso hat mit der Zunahme seines Ruhmes den Altersabstand zwischen sich und seinen Frauen immer weiter ausgedehnt: Nachdem er sich mit dreiundfünfzig Jahren von seiner Ehefrau Olga Koklova endgültig trennte, lebte er zunächst mit Dora Maar, dann mit der einundzwanzig Jahre jüngeren Françoise Gilot zusammen, mit vierundsiebzig Jahren verband er sich Jacqueline Rocque, mit achtzig heiratete er sie.
Jede neue Frau bedeutet für den Künstler eine Verjüngung, die ihm zusteht, da Genie, diese Inkarnation göttlicher Schöpferkraft, kein Alter hat. Musen sind nun einmal ewig jung; wenn sie ihre überirdische Existenz ablegen und herabsteigen in diese Welt, altern sie allerdings und müssen deshalb immer wieder erneuert werden. Françoise Gilot erzählt in ihrer Autobiographie "Leben mit Picasso" von einem Besuch im Bankhaus des Künstlers: "Als wir an jenem Tag hereinkamen, musterte uns der Wächter und grinste breit. ,Was gibt es zu lachen?' fragte ihn Pablo. Der Wächter sagte: ,Sie haben Glück. Die meisten Kunden, die ich hier gesehen habe, kommen Jahr für Jahr mit derselben Frau, und sie sieht immer ein wenig älter aus. Jedesmal, wenn Sie kommen, haben Sie eine andere Frau, und jede ist jünger als die vorhergehende.'" Der Bankangestellte deutet die Verjüngung als Auszeichnung des illustren Kunden. Einem Bürger stand solche Vergünstigung bis dahin nicht zu. Casals belustigte bei seiner Hochzeit mit der Frau, die seine Enkelin hätte sein können, das Staunen seiner bürgerlichen Gäste: "Es blieb mir damals nicht verborgen", schreibt er in seiner Erinnerungen "Licht und Schatten", "daß manche Leute auf einen gewissen Altersunterschied aufmerksam wurden - und es ist ja wirklich nicht die Regel, daß ein Bräutigam dreißig Jahre älter ist als sein Schwiegervater."
Mittlerweile ist es allerdings zur Regel geworden, daß der erfolgreiche Mann sich mit einer neuen Frau belohnt. Vom Germanistikprofessor, der sich seit den sechziger Jahren als revolutionslüsterner Bohèmien verkleidete, bis zum Topmanager und Politiker von heute reicht die Oberschicht der Verjüngungskünstler, die sich als eigene Klasse von den historisch oder beruflich Zurückgebliebenen absetzt, die mit ihrer Ehefrau gemeinsam alt werden.
In der demokratischen Gesellschaft werden Klassenunterschiede zwar nivelliert, aber durch Vergünstigungen ersetzt. Die junge Frau ist im wörtlichen Sinne der "Pour le mérite" des Erfolgreichen. Die junge Frau neben dem gereiften Mann tritt als Allegorie eines neuen zeitgemäßen Leistungsmodells auf. Bis in die siebziger Jahre hinein galt Verantwortlichkeit als höchste Tugend einer Führungskraft; heute zeichnet sie sich durch Dynamik, Erfindungsgeist, Einfallsreichtum aus - jeder Politiker, jeder Manager ein Künstler! Diesem Persönlichkeitsmuster haben die Karrieremacher ihre privaten Lebensentwürfe anzupassen. Die Verantwortung für Familie und Firma galten einst gleich viel. Eine Ehefrau "sitzenzulassen" wurde als Charakterschwäche ausgelegt, die es nicht ratsam erscheinen ließ, ein ganzes Unternehmen in solch unzuverlässige Hände zu legen. Heute nimmt man die Eroberung einer neuen Partnerin als Facelifting, wie es auch jedem Unternehmen gut anstehen würde. Es bestätigt sich in diesem Akt die Aufgeschlossenheit des ältlichen Bräutigams für die Jugend, sein Verständnis für eine nachwachsende Käuferschicht, seine Aufmerksamkeit auf den fortschrittlichen Geist der Zeit.
Zu allen Zeiten nahmen alte Männer gerne junge Frauen, doch war dieses Vergnügen nie als Frauenwechsel gesellschaftlich akzeptiert oder gar gefordert. Die vielen Kindbettopfer machten oft eine Neuverheiratung nötig, der verheiratete Mann aber wahrte nach außen hin die Sitte und spielte den Frauenhelden im Alkoven seiner Mägde, im Absteigequartier einer Kokotte oder, ganz bürgerlicher Aristokrat, bei einer Mätresse, die er fernab von seinem Haus einquartierte. Solche Geheimnistuerei hat erst der Freiheits- und Wahrheitsfanatismus unserer Zeit in Verruf gebracht. Noch der alte Benn verhält sich gegenüber seiner jungen Freundin Ursula Ziebarth, die die Libertinage in der Künstlerkolonie Worpswede kennengelernt hatte, so altmodisch, wie es heute nicht mehr denkbar wäre: "Deine Worpsweder Üsancen in Ehren, aber meine gesellschaftlichen muß ich nun doch stärker betonen. Ich bin kein Libertin u. bin nicht unanständig erzogen. Ich werde immer u. von jetzt an noch mehr die äusseren gesellschaftlichen Züge mehr betonen, auch für Dich u. in Deinem Interesse."
In der Literatur war der alte Mann mit der jungen Frau immer ein Komödiensujet und ist es bis zu Italo Svevo geblieben. Erst Phillip Roth gelingt es, den komischen Alten mit tiefer Tragik zu umgeben. Weil das Sujet dem Mitgefühl aller verlassenen oder noch geliebten Ehegattinnen so sehr gefällt, ließ er nun seinem früheren Roman "Der menschliche Makel" einen zweiten, "Das sterbende Tier", mit demselben Thema folgen. Roths einundsiebzigjähriger Held empfindet den Altersunterschied zu seiner vierunddreißigjährigen Freundin ganz anders als der selbstbewußte Künstler Casals. In die Peinlichkeit dieses Verhältnisses hat den Helden Coleman Silk eine zweifelhafte Errungenschaft der Medizin gebracht: "Ohne Viagra wäre das alles nicht passiert", so räsoniert der alte Professor über sein "Last-minute-Abenteuer". Er seufzt: "Ohne Viagra besäße ich die Würde eines älteren Gentleman, der sich korrekt benimmt. Ohne Viagra könnte ich in den letzten Jahren meines Lebens fortfahren, die weite unpersönliche Perspektive eines in Ehren pensionierten Mannes zu entwickeln. Ich könnte fortfahren, tiefgründige philosophische Schlüsse zu ziehen und stützenden moralischen Einfluß auf die junge Generation zu nehmen."
Das Verhältnis alter Mann - junge Frau durchschreitet im Laufe seiner Geschichte drei Zustände, die sowohl die Betroffenen wie die Zuschauer erfaßt: die Lächerlichkeit, die Peinlichkeit und die Bewunderung. Die Geschichte der unverhältnismäßigen Brautwerbung hat ihre Wendepunkte, wie fast alle kulturellen Erscheinungen, im achtzehnten und im zwanzigsten Jahrhundert. Im siebzehnten Jahrhundert entsteht noch die bekannteste Komödie über die Unwürde des alternden Liebhabers, Cervantes' Novelle "Der eifersüchtige Estremadurer". Der Hagestolz entschließt sich zur Heirat mit einer blutjungen Schönen. Immerhin ist er klug genug, die Gefahren des ungleichen Verhältnisses für sich zu erkennen; deshalb macht er sein Haus zu einem fensterlosen Schrein und verschließt seinen Schatz darin. Das Gehäuse ist ein wahrer Komödienstadel aus Mißtrauen und Eifersucht; kein einziges männliches Wesen darf sich dort aufhalten: "Die Ratten darin verfolgte niemals ein Kater, nie hörte man das Gebell eines Hundes, denn alle Tiere, die der Ehegatte hielt, waren weiblichen Geschlechts. Die Figuren auf den Teppichen, die seine Säle und Gemächer zierten, waren lauter Weiber, Blumen, Landschaften."
Die Wende von der Burleske zum Melodram vollzieht sich im achtzehnten Jahrhundert, und für deutsche Leser verbindet sie sich mit Goethe. Er ist der Frauenheld der deutschen Literatur par excellence. Nach seiner Liaison mit der älteren Charlotte von Stein umgeben ihn nur noch junge und immer jüngere Mädchen: Christiane Vulpius, Sylvie von Ziegesar, Bettina Brentano, Marianne von Willemer, Ulrike von Levetzow. Die Biographen, die seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts sein Leben zum Leitbild des bildungsbürgerlichen Daseins erhoben, streifen in ihren Erzählungen den Weimarer Beamten kurz, verweilen bei der Größe des Genies und beneiden den Dichter um seine Musen.
An Goethes Leben wird den bürgerlichen Lesern klar, daß der eigentliche Lohn der Arbeit die Bewunderung junger Frauen ist. Der Ruhm wird erotisiert - und ein Jahrhundert später ist es die Erotik selbst, die berühmt macht. Die Dichter haben diesen Lebenstraum von Goethe übernommen und an ihre Leser vermittelt. Der herbe Spott, den die Komödie über den alten Mann und das Mädchen ausgoß, löst sich in Hafis, dem Dichter und Propheten des "West-östlichen Divan", und Suleika, seiner jungen Geliebten, in serene Selbstironie auf:
Wie des Goldschmieds Bazarlädchen
Vielgefärbt, geschliffne Lichter
So umgeben hübsche Mädchen
Den beinah ergrauten Dichter.
Der Prophet, dessen graues Haupt beschneit, dessen Auge getrübt ist, erfährt eine Eruption, wenn er das Lockenköpfchen seiner Geliebten kost:
Nur dies Herz es ist von Dauer
Schwillt in jugendlichstem Flor;
Unter Schnee und Nebelschauer
Rast ein Aetna mir hervor.
Die Nachkommen des Hafis, etwa Gottfried Benn, beziehen seither gern die Sprache ihres greisen Liebesgeflüsters aus dem "Divan": "Was die Namen angeht", empfiehlt er 1954 Ursula Ziebarth, "so schlage ich vor, Sie lesen im west-östlichen Divan das Gedicht: ,in tausend Formen magst Du Dich verstecken'".
Die erotischen Chancen, die ihm seine Stellung im Staat und in der literarischen Welt zuspielten, blieben für Goethe dennoch nie unproblematisch. Sein ganzes Werk ist getränkt vom Bewußtsein der Peinlichkeit, in die die Gunst des Schicksals den alternden Mann mit jungen Frauen versetzen kann. Schließlich hat er sein Hauptwerk "Faust" noch in einer Epoche begonnen, da der alte Mann und das Mädchen nur als Komödienthema besprechbar waren. Die Verjüngungszeremonien Fausts umschwebt denn auch etwas von faulem Zauber. Sobald eine Frau durch teuflisches Brimborium gewonnen ist, beginnen Fausts Verlegenheiten. Gretchen, Helena und "eine Büßerin" bedrängen ihn mit kleinbürgerlicher Belehrung, mit theatralischem Gehabe, mit mystischer Bekehrung.
Im "Mann von funfzig Jahren" hat er das Problem des alternden Mannes als novellistische Tragikomödie behandelt. Die Passagen, in denen sich der überreife Liebhaber durch kosmetische Eingriffe die Jugend zurückzaubern will, richten sich satirisch gegen alle künstliche Auffrischung im Alter: "Dem Major war vor kurzem ein Vorderzahn ausgefallen, und er fürchtete, den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu denken, und mit diesem Mangel um eine junge Geliebte zu werben fing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen. Es ist ihm, als wenn der Schlußstein seines organischen Wesens entfremdet wäre und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzustürzen drohte."
Der "Mann von funfzig Jahren" ist eine Leitfigur im Werk Goethes. Auch Faust ist ein Mann von "funfzig" Jahren, Eduard in den "Wahlverwandtschaften" gehört zu dieser Gattung der verlegenen Liebesritter, selbst Wilhelm Meister und Mignon trennt ein problematischer Altersunterschied. Seither sind alle Männer Goetheaner. Wenn die junge Frau heute für den erfolgreichen Mann eine Art "Pour le mérite" darstellt, so ging dem, vor allem für die Dichter, die Goethemedaille voraus. Denn es bleibt noch lange den Dichtern überlassen, die neue Chance vorzuleben oder zur Tragödie zu verarbeiten. Jakob Wassermann etwa schreibt 1913 ein Drama mit dem Titel "Ein Mann von vierzig Jahren", der Belgier F. Hellens 1951 "L'homme de soixante ans", in dem sich ein Professor in sein Dienstmädchen verliebt; Ibsens "Baumeister Solneß" verarbeitet die Beziehung des einundsechzigjährigen Dichters zu der jungen Wienerin Emilie Burdach.
Auch der Roman eignet sich das Sujet an, man denke an Heinrich Manns "Professor Unrat" und die aparteste Bearbeitung dieses Sujets überhaupt, an "Lolita". Der Gelehrte spielt in diesen frühen Tragödien die Hauptrolle, weil das Alter dem Geist zugeordnet ist, den das letzte Aufbegehren des Körpers in einen tragischen und daher literaturwürdigen Zustand versetzt. Entweder geistig oder moralisch mußte man das Verhältnis aufwerten, um es ernst nehmen zu können. Deshalb kann erst in der Epoche der romantischen Liebe, der Körperfunktionen nur Impulse zu geistiger Begattung sind, die Liebe des alten Mannes, des Weisen oder Gelehrten, zur jungen Frau geradezu als Steigerung seines Wertes anerkannt werden.
Freilich müssen auch die Frauen avancieren, um die Begeisterung eines gereiften Geistes für sie glaubwürdig zu machen. Sie entwickeln sich von der Muse, die das Werk inspiriert, zur Verehrerin, die den Mann über seinem Werk vergißt, zur Schülerin, die durch das Werk über sich selbst hinauswächst, und schließlich zur Emanze, die zuerst gemeinsam mit dem bewunderten Vorbild und schließlich gegen ihn ihr eigenes Werk schafft.
Auch diese jungen Frauen bringt Goethe als erster zum Sprechen. Die Verehrung aus dem Varnhagen-Kreis, Rahels und ihrer Freundinnen, bedarf allerdings der Unterstützung durch Rahels Ehemann, der die Bewundererpost an Goethe expediert und später publiziert. Bettina Brentano aber verfaßt, wenngleich erst nach Goethes Tod und selbst schon in fortgeschrittenem Alter, mit "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" die Bibel aller Freundinnen bedeutender Männer. Aus einem Stückchen Leben, der Bekanntschaft Bettina Brentanos mit Goethe, war ein einflußreiches Kapitel Literatur entstanden, und aus der Literatur ging wieder Leben hervor.
Nach so vielen literarischen Vorbereitungen von Künstlern blieb alternden Männern gar nichts anderes übrig, als ihr Glück bei den jungen Frauen auch in der Wirklichkeit zu versuchen. Der neue Lebensentwurf wurde schließlich sogar wissenschaftlich für gut befunden; im zwanzigsten Jahrhundert entwickelt sich eine eigene Disziplin "Alterssexualität". In den fünfziger und sechziger Jahren bezogen sich ihre Überlegungen noch auf die Liebe zwischen zwei gleichaltrigen Senioren, seit sich aber der Übermut überreifer Männer viel jüngeren Frauen zuwendet, bedarf die Ermutigung eines schneidigeren Ansporns: ",Groß wird an der Grenze jegliches Gefühl', schrieb Rainer Maria Rilke. Es gibt aus dieser Sicht keine ,Alterssexualität', wohl eine Bewegung der Überschreitung bei einem gesteigerten Wissen um die Grenze", philosophierte 1995 Leopold Rosenmayr in einem Aufsatz über "Eros und Sexus im Alter". Es gelingt den Streitern für die erotische Emanzipation des alten Mannes, Nachteile in Vorteile umzudeuten; die abnehmende sexuelle Lust sei, so heißt es, dem weiblichen Gefühl angemessener als die stürmischen Attacken der Jugend. Die Bedächtigkeit der Werbung "vermag der geliebten Frau verstärkte Erlebnisdimensionen der Geschlechtlichkeit zu vermitteln".
Über Literatur und Wirklichkeit reflektiert Italo Svevo in seiner "Novelle vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen". Die Novelle enthält eine Psychologie des Alters, die selbst noch die Vergeistigung der Liebe als den schützenden Wahn dessen entlarvt, der nicht abtreten will. Hinter der Heiterkeit von Svevos Stil verbirgt sich ein erbarmungsloser Zynismus. Die junge Frau, ein schönes Bild, widerstrebt dem Angriff der verzweifelten Hoffnung. Der alte Mann versucht ihr - und sich selbst - mit Argumenten beizukommen und wird darüber zum philosophischen Schriftsteller. Er sammelt alle Beweise für die hohe Geistigkeit seiner Altersliebe: "Einfach ist die Liebe auch für die alten Herren nicht. Unser alter Herr sagte sich: ,Das ist mein erstes echtes Liebesabenteuer seit dem Tode meiner Frau.' Man kann sagen, daß ein alter Mann selten jung genug ist, ein Liebesabenteuer zu erleben, das nicht echt wäre." Schließlich schreibt der Alte nur noch über die Entsagung in der Liebe: Die Theorie ist seine letzte Geliebte - und auch sie läßt ihn im Stich, denn "was ihm schwerfiel, war, die Theorie auch für sich zu akzeptieren".
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Casals war fünfundsiebzig Jahre alt, als er 1951 Marita Montañez kennenlernte, sie war vierzehn. Drei Jahre später wurde sie seine Schülerin, 1957 heiratete der Cellist die um einundsechzig Jahre Jüngere. Picasso hat mit der Zunahme seines Ruhmes den Altersabstand zwischen sich und seinen Frauen immer weiter ausgedehnt: Nachdem er sich mit dreiundfünfzig Jahren von seiner Ehefrau Olga Koklova endgültig trennte, lebte er zunächst mit Dora Maar, dann mit der einundzwanzig Jahre jüngeren Françoise Gilot zusammen, mit vierundsiebzig Jahren verband er sich Jacqueline Rocque, mit achtzig heiratete er sie.
Jede neue Frau bedeutet für den Künstler eine Verjüngung, die ihm zusteht, da Genie, diese Inkarnation göttlicher Schöpferkraft, kein Alter hat. Musen sind nun einmal ewig jung; wenn sie ihre überirdische Existenz ablegen und herabsteigen in diese Welt, altern sie allerdings und müssen deshalb immer wieder erneuert werden. Françoise Gilot erzählt in ihrer Autobiographie "Leben mit Picasso" von einem Besuch im Bankhaus des Künstlers: "Als wir an jenem Tag hereinkamen, musterte uns der Wächter und grinste breit. ,Was gibt es zu lachen?' fragte ihn Pablo. Der Wächter sagte: ,Sie haben Glück. Die meisten Kunden, die ich hier gesehen habe, kommen Jahr für Jahr mit derselben Frau, und sie sieht immer ein wenig älter aus. Jedesmal, wenn Sie kommen, haben Sie eine andere Frau, und jede ist jünger als die vorhergehende.'" Der Bankangestellte deutet die Verjüngung als Auszeichnung des illustren Kunden. Einem Bürger stand solche Vergünstigung bis dahin nicht zu. Casals belustigte bei seiner Hochzeit mit der Frau, die seine Enkelin hätte sein können, das Staunen seiner bürgerlichen Gäste: "Es blieb mir damals nicht verborgen", schreibt er in seiner Erinnerungen "Licht und Schatten", "daß manche Leute auf einen gewissen Altersunterschied aufmerksam wurden - und es ist ja wirklich nicht die Regel, daß ein Bräutigam dreißig Jahre älter ist als sein Schwiegervater."
Mittlerweile ist es allerdings zur Regel geworden, daß der erfolgreiche Mann sich mit einer neuen Frau belohnt. Vom Germanistikprofessor, der sich seit den sechziger Jahren als revolutionslüsterner Bohèmien verkleidete, bis zum Topmanager und Politiker von heute reicht die Oberschicht der Verjüngungskünstler, die sich als eigene Klasse von den historisch oder beruflich Zurückgebliebenen absetzt, die mit ihrer Ehefrau gemeinsam alt werden.
In der demokratischen Gesellschaft werden Klassenunterschiede zwar nivelliert, aber durch Vergünstigungen ersetzt. Die junge Frau ist im wörtlichen Sinne der "Pour le mérite" des Erfolgreichen. Die junge Frau neben dem gereiften Mann tritt als Allegorie eines neuen zeitgemäßen Leistungsmodells auf. Bis in die siebziger Jahre hinein galt Verantwortlichkeit als höchste Tugend einer Führungskraft; heute zeichnet sie sich durch Dynamik, Erfindungsgeist, Einfallsreichtum aus - jeder Politiker, jeder Manager ein Künstler! Diesem Persönlichkeitsmuster haben die Karrieremacher ihre privaten Lebensentwürfe anzupassen. Die Verantwortung für Familie und Firma galten einst gleich viel. Eine Ehefrau "sitzenzulassen" wurde als Charakterschwäche ausgelegt, die es nicht ratsam erscheinen ließ, ein ganzes Unternehmen in solch unzuverlässige Hände zu legen. Heute nimmt man die Eroberung einer neuen Partnerin als Facelifting, wie es auch jedem Unternehmen gut anstehen würde. Es bestätigt sich in diesem Akt die Aufgeschlossenheit des ältlichen Bräutigams für die Jugend, sein Verständnis für eine nachwachsende Käuferschicht, seine Aufmerksamkeit auf den fortschrittlichen Geist der Zeit.
Zu allen Zeiten nahmen alte Männer gerne junge Frauen, doch war dieses Vergnügen nie als Frauenwechsel gesellschaftlich akzeptiert oder gar gefordert. Die vielen Kindbettopfer machten oft eine Neuverheiratung nötig, der verheiratete Mann aber wahrte nach außen hin die Sitte und spielte den Frauenhelden im Alkoven seiner Mägde, im Absteigequartier einer Kokotte oder, ganz bürgerlicher Aristokrat, bei einer Mätresse, die er fernab von seinem Haus einquartierte. Solche Geheimnistuerei hat erst der Freiheits- und Wahrheitsfanatismus unserer Zeit in Verruf gebracht. Noch der alte Benn verhält sich gegenüber seiner jungen Freundin Ursula Ziebarth, die die Libertinage in der Künstlerkolonie Worpswede kennengelernt hatte, so altmodisch, wie es heute nicht mehr denkbar wäre: "Deine Worpsweder Üsancen in Ehren, aber meine gesellschaftlichen muß ich nun doch stärker betonen. Ich bin kein Libertin u. bin nicht unanständig erzogen. Ich werde immer u. von jetzt an noch mehr die äusseren gesellschaftlichen Züge mehr betonen, auch für Dich u. in Deinem Interesse."
In der Literatur war der alte Mann mit der jungen Frau immer ein Komödiensujet und ist es bis zu Italo Svevo geblieben. Erst Phillip Roth gelingt es, den komischen Alten mit tiefer Tragik zu umgeben. Weil das Sujet dem Mitgefühl aller verlassenen oder noch geliebten Ehegattinnen so sehr gefällt, ließ er nun seinem früheren Roman "Der menschliche Makel" einen zweiten, "Das sterbende Tier", mit demselben Thema folgen. Roths einundsiebzigjähriger Held empfindet den Altersunterschied zu seiner vierunddreißigjährigen Freundin ganz anders als der selbstbewußte Künstler Casals. In die Peinlichkeit dieses Verhältnisses hat den Helden Coleman Silk eine zweifelhafte Errungenschaft der Medizin gebracht: "Ohne Viagra wäre das alles nicht passiert", so räsoniert der alte Professor über sein "Last-minute-Abenteuer". Er seufzt: "Ohne Viagra besäße ich die Würde eines älteren Gentleman, der sich korrekt benimmt. Ohne Viagra könnte ich in den letzten Jahren meines Lebens fortfahren, die weite unpersönliche Perspektive eines in Ehren pensionierten Mannes zu entwickeln. Ich könnte fortfahren, tiefgründige philosophische Schlüsse zu ziehen und stützenden moralischen Einfluß auf die junge Generation zu nehmen."
Das Verhältnis alter Mann - junge Frau durchschreitet im Laufe seiner Geschichte drei Zustände, die sowohl die Betroffenen wie die Zuschauer erfaßt: die Lächerlichkeit, die Peinlichkeit und die Bewunderung. Die Geschichte der unverhältnismäßigen Brautwerbung hat ihre Wendepunkte, wie fast alle kulturellen Erscheinungen, im achtzehnten und im zwanzigsten Jahrhundert. Im siebzehnten Jahrhundert entsteht noch die bekannteste Komödie über die Unwürde des alternden Liebhabers, Cervantes' Novelle "Der eifersüchtige Estremadurer". Der Hagestolz entschließt sich zur Heirat mit einer blutjungen Schönen. Immerhin ist er klug genug, die Gefahren des ungleichen Verhältnisses für sich zu erkennen; deshalb macht er sein Haus zu einem fensterlosen Schrein und verschließt seinen Schatz darin. Das Gehäuse ist ein wahrer Komödienstadel aus Mißtrauen und Eifersucht; kein einziges männliches Wesen darf sich dort aufhalten: "Die Ratten darin verfolgte niemals ein Kater, nie hörte man das Gebell eines Hundes, denn alle Tiere, die der Ehegatte hielt, waren weiblichen Geschlechts. Die Figuren auf den Teppichen, die seine Säle und Gemächer zierten, waren lauter Weiber, Blumen, Landschaften."
Die Wende von der Burleske zum Melodram vollzieht sich im achtzehnten Jahrhundert, und für deutsche Leser verbindet sie sich mit Goethe. Er ist der Frauenheld der deutschen Literatur par excellence. Nach seiner Liaison mit der älteren Charlotte von Stein umgeben ihn nur noch junge und immer jüngere Mädchen: Christiane Vulpius, Sylvie von Ziegesar, Bettina Brentano, Marianne von Willemer, Ulrike von Levetzow. Die Biographen, die seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts sein Leben zum Leitbild des bildungsbürgerlichen Daseins erhoben, streifen in ihren Erzählungen den Weimarer Beamten kurz, verweilen bei der Größe des Genies und beneiden den Dichter um seine Musen.
An Goethes Leben wird den bürgerlichen Lesern klar, daß der eigentliche Lohn der Arbeit die Bewunderung junger Frauen ist. Der Ruhm wird erotisiert - und ein Jahrhundert später ist es die Erotik selbst, die berühmt macht. Die Dichter haben diesen Lebenstraum von Goethe übernommen und an ihre Leser vermittelt. Der herbe Spott, den die Komödie über den alten Mann und das Mädchen ausgoß, löst sich in Hafis, dem Dichter und Propheten des "West-östlichen Divan", und Suleika, seiner jungen Geliebten, in serene Selbstironie auf:
Wie des Goldschmieds Bazarlädchen
Vielgefärbt, geschliffne Lichter
So umgeben hübsche Mädchen
Den beinah ergrauten Dichter.
Der Prophet, dessen graues Haupt beschneit, dessen Auge getrübt ist, erfährt eine Eruption, wenn er das Lockenköpfchen seiner Geliebten kost:
Nur dies Herz es ist von Dauer
Schwillt in jugendlichstem Flor;
Unter Schnee und Nebelschauer
Rast ein Aetna mir hervor.
Die Nachkommen des Hafis, etwa Gottfried Benn, beziehen seither gern die Sprache ihres greisen Liebesgeflüsters aus dem "Divan": "Was die Namen angeht", empfiehlt er 1954 Ursula Ziebarth, "so schlage ich vor, Sie lesen im west-östlichen Divan das Gedicht: ,in tausend Formen magst Du Dich verstecken'".
Die erotischen Chancen, die ihm seine Stellung im Staat und in der literarischen Welt zuspielten, blieben für Goethe dennoch nie unproblematisch. Sein ganzes Werk ist getränkt vom Bewußtsein der Peinlichkeit, in die die Gunst des Schicksals den alternden Mann mit jungen Frauen versetzen kann. Schließlich hat er sein Hauptwerk "Faust" noch in einer Epoche begonnen, da der alte Mann und das Mädchen nur als Komödienthema besprechbar waren. Die Verjüngungszeremonien Fausts umschwebt denn auch etwas von faulem Zauber. Sobald eine Frau durch teuflisches Brimborium gewonnen ist, beginnen Fausts Verlegenheiten. Gretchen, Helena und "eine Büßerin" bedrängen ihn mit kleinbürgerlicher Belehrung, mit theatralischem Gehabe, mit mystischer Bekehrung.
Im "Mann von funfzig Jahren" hat er das Problem des alternden Mannes als novellistische Tragikomödie behandelt. Die Passagen, in denen sich der überreife Liebhaber durch kosmetische Eingriffe die Jugend zurückzaubern will, richten sich satirisch gegen alle künstliche Auffrischung im Alter: "Dem Major war vor kurzem ein Vorderzahn ausgefallen, und er fürchtete, den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu denken, und mit diesem Mangel um eine junge Geliebte zu werben fing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen. Es ist ihm, als wenn der Schlußstein seines organischen Wesens entfremdet wäre und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzustürzen drohte."
Der "Mann von funfzig Jahren" ist eine Leitfigur im Werk Goethes. Auch Faust ist ein Mann von "funfzig" Jahren, Eduard in den "Wahlverwandtschaften" gehört zu dieser Gattung der verlegenen Liebesritter, selbst Wilhelm Meister und Mignon trennt ein problematischer Altersunterschied. Seither sind alle Männer Goetheaner. Wenn die junge Frau heute für den erfolgreichen Mann eine Art "Pour le mérite" darstellt, so ging dem, vor allem für die Dichter, die Goethemedaille voraus. Denn es bleibt noch lange den Dichtern überlassen, die neue Chance vorzuleben oder zur Tragödie zu verarbeiten. Jakob Wassermann etwa schreibt 1913 ein Drama mit dem Titel "Ein Mann von vierzig Jahren", der Belgier F. Hellens 1951 "L'homme de soixante ans", in dem sich ein Professor in sein Dienstmädchen verliebt; Ibsens "Baumeister Solneß" verarbeitet die Beziehung des einundsechzigjährigen Dichters zu der jungen Wienerin Emilie Burdach.
Auch der Roman eignet sich das Sujet an, man denke an Heinrich Manns "Professor Unrat" und die aparteste Bearbeitung dieses Sujets überhaupt, an "Lolita". Der Gelehrte spielt in diesen frühen Tragödien die Hauptrolle, weil das Alter dem Geist zugeordnet ist, den das letzte Aufbegehren des Körpers in einen tragischen und daher literaturwürdigen Zustand versetzt. Entweder geistig oder moralisch mußte man das Verhältnis aufwerten, um es ernst nehmen zu können. Deshalb kann erst in der Epoche der romantischen Liebe, der Körperfunktionen nur Impulse zu geistiger Begattung sind, die Liebe des alten Mannes, des Weisen oder Gelehrten, zur jungen Frau geradezu als Steigerung seines Wertes anerkannt werden.
Freilich müssen auch die Frauen avancieren, um die Begeisterung eines gereiften Geistes für sie glaubwürdig zu machen. Sie entwickeln sich von der Muse, die das Werk inspiriert, zur Verehrerin, die den Mann über seinem Werk vergißt, zur Schülerin, die durch das Werk über sich selbst hinauswächst, und schließlich zur Emanze, die zuerst gemeinsam mit dem bewunderten Vorbild und schließlich gegen ihn ihr eigenes Werk schafft.
Auch diese jungen Frauen bringt Goethe als erster zum Sprechen. Die Verehrung aus dem Varnhagen-Kreis, Rahels und ihrer Freundinnen, bedarf allerdings der Unterstützung durch Rahels Ehemann, der die Bewundererpost an Goethe expediert und später publiziert. Bettina Brentano aber verfaßt, wenngleich erst nach Goethes Tod und selbst schon in fortgeschrittenem Alter, mit "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" die Bibel aller Freundinnen bedeutender Männer. Aus einem Stückchen Leben, der Bekanntschaft Bettina Brentanos mit Goethe, war ein einflußreiches Kapitel Literatur entstanden, und aus der Literatur ging wieder Leben hervor.
Nach so vielen literarischen Vorbereitungen von Künstlern blieb alternden Männern gar nichts anderes übrig, als ihr Glück bei den jungen Frauen auch in der Wirklichkeit zu versuchen. Der neue Lebensentwurf wurde schließlich sogar wissenschaftlich für gut befunden; im zwanzigsten Jahrhundert entwickelt sich eine eigene Disziplin "Alterssexualität". In den fünfziger und sechziger Jahren bezogen sich ihre Überlegungen noch auf die Liebe zwischen zwei gleichaltrigen Senioren, seit sich aber der Übermut überreifer Männer viel jüngeren Frauen zuwendet, bedarf die Ermutigung eines schneidigeren Ansporns: ",Groß wird an der Grenze jegliches Gefühl', schrieb Rainer Maria Rilke. Es gibt aus dieser Sicht keine ,Alterssexualität', wohl eine Bewegung der Überschreitung bei einem gesteigerten Wissen um die Grenze", philosophierte 1995 Leopold Rosenmayr in einem Aufsatz über "Eros und Sexus im Alter". Es gelingt den Streitern für die erotische Emanzipation des alten Mannes, Nachteile in Vorteile umzudeuten; die abnehmende sexuelle Lust sei, so heißt es, dem weiblichen Gefühl angemessener als die stürmischen Attacken der Jugend. Die Bedächtigkeit der Werbung "vermag der geliebten Frau verstärkte Erlebnisdimensionen der Geschlechtlichkeit zu vermitteln".
Über Literatur und Wirklichkeit reflektiert Italo Svevo in seiner "Novelle vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen". Die Novelle enthält eine Psychologie des Alters, die selbst noch die Vergeistigung der Liebe als den schützenden Wahn dessen entlarvt, der nicht abtreten will. Hinter der Heiterkeit von Svevos Stil verbirgt sich ein erbarmungsloser Zynismus. Die junge Frau, ein schönes Bild, widerstrebt dem Angriff der verzweifelten Hoffnung. Der alte Mann versucht ihr - und sich selbst - mit Argumenten beizukommen und wird darüber zum philosophischen Schriftsteller. Er sammelt alle Beweise für die hohe Geistigkeit seiner Altersliebe: "Einfach ist die Liebe auch für die alten Herren nicht. Unser alter Herr sagte sich: ,Das ist mein erstes echtes Liebesabenteuer seit dem Tode meiner Frau.' Man kann sagen, daß ein alter Mann selten jung genug ist, ein Liebesabenteuer zu erleben, das nicht echt wäre." Schließlich schreibt der Alte nur noch über die Entsagung in der Liebe: Die Theorie ist seine letzte Geliebte - und auch sie läßt ihn im Stich, denn "was ihm schwerfiel, war, die Theorie auch für sich zu akzeptieren".
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


