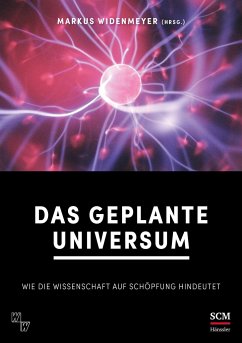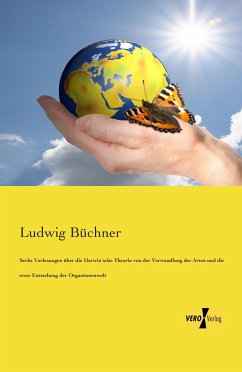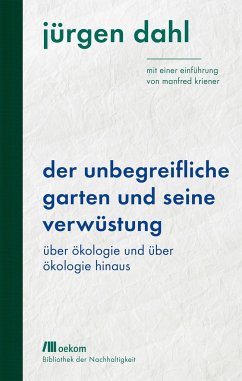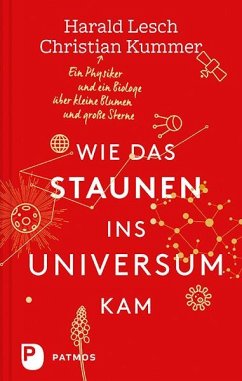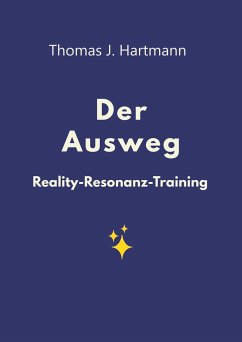Jules-Verne-Methode ausmalt, dann wird es der Zukunftsmensch selbstverständlich nicht beim Mammut belassen. Die Guten werden uns dann ausgestorbene Tiere wiederbringen und selbstleuchtende Bäume basteln, die unsere Straßen kostenlos mit fluoreszierenden Proteinen erhellen, sie werden Möbel aus bakteriell erzeugten Kunststoffen herstellen, die ein angenehmes Meeresbrisen-Aroma verbreiten. Und die Schlechten? Tja, die könnten genauso radikal dafür sorgen, dass das alles Hirngespinste bleiben. Weil Bioterroristen nämlich früher oder später - eher früher, meint Fritsche, so um das Jahr 2020, den amerikanischen National Intelligence Council zitierend - so weit sein werden, sollten wir dann mit den ersten Terrorakten der neuen Biowaffen-Schöpfer rechnen. Gleich wahrscheinlich ist beides, das Mammut wie der Bioterror, nämlich "höchstwahrscheinlich" im prophetischen Duktus von Fritsche. Die Wiedergeburt des Neandertalers in einem Genlabor immerhin hält der Autor lediglich noch für wahrscheinlich, da fehlt der Superlativ. Aber die ersten Versuche erwartet er "wenige Jahre nach den ersten Mammuts".
Man sieht an solchen Versuchen, die biotechnische Zukunft unserer Gattung halbwegs verlässlich vorauszudenken, dass es auch als Naturwissenschaftler gelegentlich schwierig ist, eine gerade Linie zu ziehen, wenn eine wild schlingernde Phantasie das eigene Kalkül durchkreuzt. Nennen wir also Fritsches Werk, was es ist: ein in weiten Teilen spekulatives Buch. Dass Fritsche darauf beharrt, es eine Extrapolation der Gentechnik in die Zukunft à la Jules Verne zu nennen, verbuchen wir als Versuch, das Vertrauen der Leser vom ersten Moment an zu gewinnen. Das ist auch bitter nötig. Denn die Vorstellung von der ingenieursmäßigen Schöpfung neuen Lebens - keineswegs nur ausgestorbener Kreaturen, sondern auch noch völlig unbekannter, sogar molekular anders konstruierter Lebensformen -, das ist schon eine echte intellektuelle Herausforderung für das Laienpublikum. Und dieses hat der Autor fest im Blick.
Mit einem "Laborbuch" als Cartoon werden Grundbegriffe der Gentechnik erklärt, und immer wieder folgt, nachdem der Leser einige der innovativsten Orte und Bioingenieure der Gegenwart, insbesondere in den Vereinigten Staaten, kennengelernt hat, der zusammenfassende "Blick in die Zukunft". In den Zwischenkapiteln wirft sich der Autor als rasender Laborreporter genauso wie seine Protagonisten - von Biotechnik begeisterte Schüler und Studenten im alljährlichen Junioren-"iGem"-Wettstreit - den weißen Biobastlerkittel über und versprüht damit zumindest einen Hauch von dem alchimistischen Hochgefühl der neuen Biohacker-Generation.
Das Buch ist, worauf der Verlag nicht zu Unrecht hinweist, eines der ersten populären Sachbücher, das sich dieser visionären Fortsetzungsgeschichte der Gen- und Genomtechnik annimmt. Das ist angesichts der unfassbar beschleunigten, aber keineswegs ganz neuen Entwicklung auf dem Gebiet der planvollen Biokreationen schon seltsam genug. Vor wenigen Jahren hatte Craig Venter vielen Medienberichten zufolge "Gott gespielt". Auch wenn das nicht die volle Wahrheit war, wundert sich Fritsche zu Recht, warum eigentlich die Kreation von künstlichen Organsimen aus synthetisch hergestelltem Erbmaterial keine gesellschaftliche, nicht einmal eine ethische Debatte losgetreten hat.
Als es vor elf oder zwölf Jahren darum ging, die Embryonenforschung biopolitisch vor dem Zugriff einiger medizinisch interessierter Stammzellzüchter zu schützen, hatte es eine breite bioethische Diskussion quer durch alle politischen Lager und Schichten gegeben. Die fehlt bislang immer noch im Kontext der Synthetischen Biologie. Vor einigen Monaten hat dies schon eine Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in ihren Empfehlungen umfänglich beklagt. Liest man nun Fritsches Buch, entdeckt man - der Gegensatz von sperrigem Wissenschaftlerdeutsch im Akademieband und klarem Duktus bei Fritsche beiseitegesetzt - bemerkenswerte Gemeinsamkeiten. Zumindest wenn es um Genese, Ziele, Beschleunigung und die seltsame biopolitische Stille ums neue Genombasteln geht. Diese Parallelität sagt einiges über die Ernsthaftigkeit, mit der Fritsche das Thema angegangen ist.
Wenn es um das geht, was die Akademie-Arbeitsgruppe im Gentechnologiebericht "wissenschaftlicher Regelungsbedarf" nennt, gibt sich der Sachbuchautor allerdings nicht mit dem juristisch-philosophischen Lavieren der Experten zufrieden. Fritsche ist deutlich kritischer. Er fordert offensiver eine öffentliche Auseinandersetzung um die Vorgänge in den Laboren. Seine Sorge, dass sich die Menschen irgendwann und dann vermutlich zu spät fragen, ob sie das eigentlich alles genau so wollen wie die Gen-Ingenieure, diese Sorge wird von einigen Fachleuten durchaus geteilt. Nur, die wenigsten wollen das öffentlich bezeugen, oder sie freuen sich allenfalls klammheimlich, dass es einen Aufstand wie gegen die "Grüne Gentechnik" so bisher nicht gegeben hat. Fritsches Spekulationen mag man deshalb als Zündeln mit Sciencefiction abtun. Genauso gut aber könnte das Buch ein Weckruf zur rechten Zeit sein.
Olaf Fritsche: "Die neue Schöpfung". Wie Gen-Ingenieure unser Leben revolutionieren.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 288 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
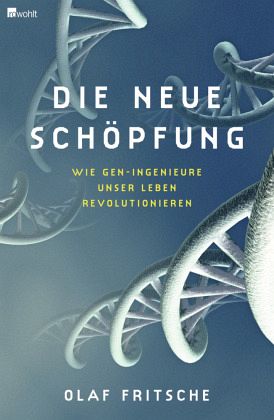



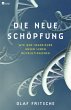

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.03.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.03.2013