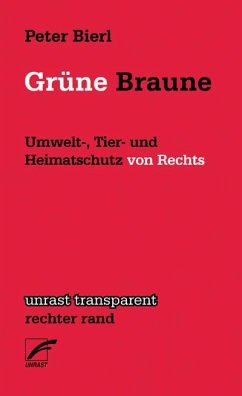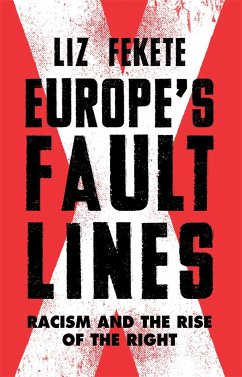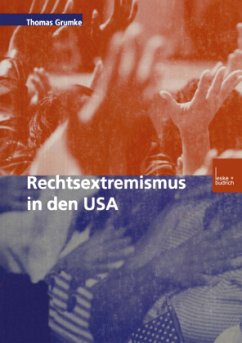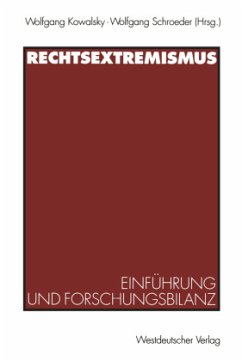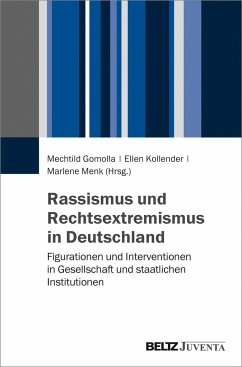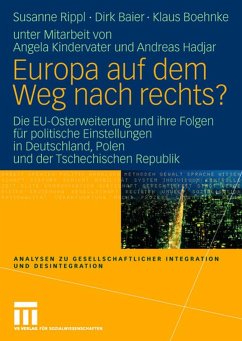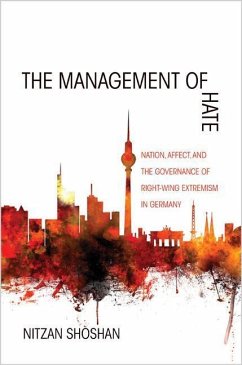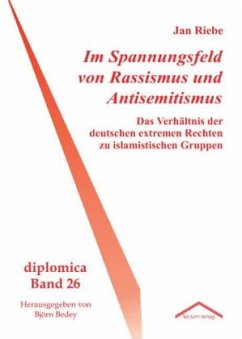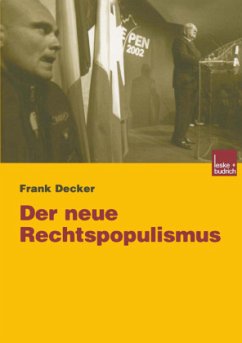Autorin, zumeist faktengetreu und diszipliniert die Versuchung zu bestehen, den Kessel Buntes namens Neue Rechte zur schwarzbraunen Fronde zu stilisieren und verinselten Protest-Vulkanismus zum dämonischen Magma einer Gegenmacht mit gezielter Subversionsstrategie aufzudonnern. Zwar seien Berührungspunkte mit Konservativen oder Extremisten vorhanden, aber eine Neue Rechte sei für das Gebiet der Bundesrepublik nicht klar zu umreißen.
Entrüstungsgehechel.
Anlaß zum Einspruch bleibt gleichwohl. So, wenn etwa von der Plagiierung der Konservativen Revolution durch die Neue Rechte die Rede ist. Dies wäre fast Anlaß zur Entwarnung. Denn das Weimarer Wahlvolk bediente in den zwanziger Jahren entscheidend seine Affekte gegen die Realität mit den Riesenauflagen der Schnulzen von Hedwig Courths-Mahler, nicht jedoch mit dem kosmischen Wortgewürfel der Zeitverächter (Ernst Jünger ausgenommen). Schlicht falsch ist der Satz: "Durch die Integration der christlich-konservativen Regierung unter Adenauer wurde der organisierte Rechtsextremismus zunächst ins bedeutungslose Abseits gedrängt." Nie wurde wohl über Rechts- und Linksextremismus so heftig gestritten wie in der Ära Adenauer, zumal in den frühen Jahren. Europas Einheit statt nationaler Großmacht, Westbindung vor Einheit polarisierten scharf im Kalten Krieg. Die Karlsruher Verbotsbegründung gegen die neonazistische SRP 1952 und gegen die ostgesteuerte KPD 1956 forderte mit dem antitotalitären Grundkonsens eine streitbare Äquidistanz zu Rechts- und Linksextremismus.
Diese Verantwortung vor dem Grundgesetz wird im heutigen Entrüstungsgehechel fast erstickt. So geißelt der "Hardliner" Andreas Molau die Trennung in demokratische und undemokratische Rechte als "unerträgliche Unterscheidung". Andererseits besteht für Michel Friedman laut Vorwort zur Studie von Brauner-Orthen bereits Anlaß zur Besorgnis, wenn die Vertreter der politischen Mitte ihre Abgrenzung zur Neuen Rechten nicht mehr klar und deutlich artikulieren. Wird es noch enger mit Toleranz, Liberalität und Streitkultur? Für Friedman entlarvt die Autorin, die "selbst kleinste Hinweise einer antidemokratischen und rassistischen Gesinnung recherchiert" habe, "die Neue Rechte als ernstzunehmende geistige Brandstifter". Dann schränkt er den Ertrag dieser Analyse ein: "Die Bilanz, daß die Neue Rechte die kulturelle Hegemonie in Deutschland nicht erobern konnte, es ihr außerdem bisher nicht gelungen sei, die Medien und die Öffentlichkeit nachhaltig zu beeinflussen und die politischen Diskurse im Land zu dominieren sowie politikfähig zu sein, mag auf Widerstand stoßen."
Immerhin vermag die Verfasserin am Ende ihrer Analyse den CDU-Abgeordneten Friedbert Pflüger als Zeugen bedenklicher Tendenzen aufzurufen: "Wer durch das Land fährt und mit der Parteibasis diskutiert, spürt an allen Ecken und Enden den Einfluß der Neuen Rechten, sieht Bürgerängste schwinden." Damit zeigt sich aber wohl weniger Einfluß der Neuen Rechten mit ihren Zirkeln und Postillen als die ansteigende soziale Aggressivität. Doch ideologische Wirr-, Holz- oder Betonköpfe rechts wie links bleiben isoliert und kontrolliert, wenn sie keine Masse kriegen. Diese wächst ihnen zu, wenn die Sicherheit des Vor-Politischen, des Selbstverständlichen verlorengeht: Rechtssicherheit und Freiheitsverantwortung durch Ordnung, Maß und Haushaltsdisziplin durch Verfassungs- plus Vernunftpatriotismus. Snobismus gegen Stammtische und Integrationsinbrunst sind preiswert zu haben. So aus der Villa im Grünen, aus dem Dienstwagen heraus.
Der Band von Klaus Kinner und Rolf Richter umfaßt Aufsätze, die unter Federführung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen gemeinsam mit der PDS in Sachsen erarbeitet wurden. "Demokratische und humanistische Politik", heißt es in ihrem Editorial, "ist per se dem Antifaschismus verpflichtet." Offenbar aber nicht dem Antikommunismus. Denn davon ist nicht die Rede. Entsprechend spielen die Autoren, deren Lebensläufe durchweg DDR-Hochschulsozialisation ausweisen, ideologisches Nachlaufen mit sich selbst und um einen Antifaschismus-Begriff herum, der inzwischen verschlissen ist.
Erstaunt in dem Sammelband die Systemkritik an der SED-Diktatur, dann fällt wohl das Eingeständnis von Schlimmem leichter, weil es anderswo noch Schlimmeres gab. So stellt Norbert Madloch in einem zumeist sehr sachkundigen Beitrag fest, "daß es einen solchen krassen Antisemitismus wie in der Sowjetunion, der Volksrepublik Polen und anderen osteuropäischen Staaten in der ganzen Zeit der DDR nie gegeben hat." Oder: "Über neunzig Prozent der nazistischen Staatsbediensteten bis hin zu höheren SS-Offizieren gelangten so in den öffentlichen Dienst der BRD und bestimmten jahrelang das geistige Klima dieses Staates." Für die eigene DDR-Vergangenheit liegen Persilscheine parat. So war nach Bischof Christoph Demke (Magdeburg) die antifaschistische Politik der DDR "im wesentlichen aufrichtig". Und Andreas Nachama, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Berlin, sekundiert: "Nicht alles war falsch."
Traditionseinlagerungen.
Hängt man die Antifa-Kostüme der Geschichtspolitisierung weg, bleiben zwei Themenkreise von Gewicht. Einmal beeindruckt Klaus Kinners Report über den kommunistischen Antifaschismus als schwieriges Erbe. In dieser skalpellscharfen Studie über Stalins Verrat am Antifaschismus berichtet Kinner über Moskaus Wunsch nach einem Roten Oktober. Karl Radek sei damals angeraten worden, daß statt Theorie-Hegemonie "ein guter Faustschlag am besten den Faschismus zerlegen würde".
Zweitens bohrt Norbert Madloch Erinnerungsschächte auf und erfaßt die Traditionseinlagerungen von Antisemitismus, Militarismus, Autoritarismus bis zum Skinheadwesen der Gegenwart samt den nachwachsenden Xenophobien in den alten und vor allem in den neuen Ländern. Fünfhunderttausend Angehörige der Sowjetarmee blieben in der DDR ghettoisiert. In den siebziger Jahren kamen achtzehntausend Algerier als Arbeitskräfte; wegen sozialer Unverträglichkeit wurde deren Rückführung rasch notwendig. Trotz staatlicher Verordnung von Internationalismus und Völkerfreundschaft wünschte man in der DDR kein Seßhaftwerden von Ausländern. Irene Runge wird von Madloch zitiert: "Im Betrieb Kollege - in der Freizeit oft Fremde."
MANFRED FUNKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
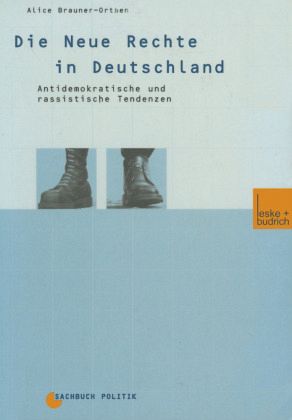






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.11.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.11.2001