ihres Vorgängers zu brechen. Gerhard Schröder hat wegen seiner Freundschaft mit Putin zur Vernichtung der Freiheit in Rußland geschwiegen." Seit Putin an die Macht gekommen ist, sind nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" mindestens vierzehn Journalisten in Rußland ermordet worden. Rußland ist ein Land zum Fürchten - zumindest haben zum Fürchten all jene Anlaß, die sich für Demokratie und Bürgerrechte einsetzen und gegen die Machenschaften der dort regierenden Klans protestieren.
Elena Tregubova gehörte einmal als Korrespondentin der Moskauer Tageszeitung "Kommersant" zu jenen Journalisten, die Zugang zum Kreml und zu dessen Pressesprecherreich hatten. Fünf Jahre lang hatte sie sich dort im engen Umkreis der Macht bewegen dürfen und dabei alle möglichen und alle unmöglichen Machtmenschen aus der Nähe kennengelernt, darunter auch, und zwar schon in frühen Jahren, den späteren Staatschef Wladimir Putin. "Man darf nicht vergessen", schreibt Tregubova in ihrem Buch "Mutanten des Kreml", "daß der Mann, der heute an der Spitze des russischen Staates steht, in seiner Jugend bewußt und aus freien Stücken zum KGB gegangen ist. Zu einem Geheimdienst, der die Andersdenkenden im Land physisch vernichtete, einem Geheimdienst, der Millionen von Menschen umgebracht hat."
Elena Tregubova muß in diesen fünf Jahren am Kreml-Hof manchmal sehr große, sehr blaue Augen gemacht haben: Die Macht irritiert, die Macht blendet manchmal. Als Putin, mit dem sie ganz am Anfang einmal Sushi essen war, dann seine Macht mit allen Mitteln ausbaute, verfinsterte sich Elena Tregubovas Blick zunehmend, und sie schrieb Artikel, die den Mächtigen nicht gefallen konnten. Putin entzog ihr die Akkreditierung für den Kreml - einer von zahlreichen Vorgängen, die nach Tregubova zur Vernichtung der Pressefreiheit in Putins Rußland führten. Schließlich hat sie sich für einige Wochen in ihr Zimmer zurückgezogen und das Buch "Geschichten eines Kreml-Diggers" geschrieben, das nach langem Suchen nach einem mutigen Verleger im Kleinverlag "Ad marginem" erschienen ist. Auf der Frankfurter Buchmesse vor drei Jahren ist ihre Abrechnung mit dem Kremlsystem unter Putin zum allerersten Mal in das Licht der Öffentlichkeit gekommen. Ihr Verleger Alexander Iwanow, der auch die Romane des Schriftstellers Wladimir Sorokin publiziert, hatte nur fünf Exemplare des Buches in seinem Koffer, als er nach Frankfurt zur Messe fuhr, und die stellte er dort sofort an seinem Stand ins Regal, wo sie nicht lange blieben. Die Auslieferung der gedruckten Exemplare hat sich in Rußland aus unerklärlichen Gründen tagelang verzögert.
Von Frankfurt eilte die Nachricht von diesem Buch sofort zurück nach Moskau, wo sie nicht nur in den Medien wie eine Bombe eingeschlagen haben muß. Bald kursierten kopierte Exemplare des Buches, weil die Druckerei noch immer nicht imstande war zu liefern - das schaffte sie aber schließlich. Das Buch machte Furore (siehe F.A.Z. vom 6. Dezember 2003) und wurde mehrere Zigtausend Male verkauft. Die Journalistin Elena Tregubova, geboren 1973, wurde berühmt.
Nun liegt dieses Buch in einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung, ergänzt von einer ebenfalls überarbeiteten und aktualisierten Fassung ihres Buches "Der Abschied eines Kreml-Diggers", auf deutsch vor: eine professionell auf Wirkung geschriebene vitale und offenherzige Mischung aus harter Kritik am und kalkuliertem Klatsch aus dem Kreml.
Das Buch ist keine soziologische Machtanalyse, das hätten dann wahrscheinlich auch weniger Leute gelesen, sondern der temperamentvolle Erfahrungsbericht einer Journalistin über die Machenschaften in einem Land, das weit von der Demokratie entfernt ist und in dem die Wahrheit zu sagen und eine andere Richtung als die Mächtigen einzuschlagen eine gefährliche Sache ist, für die gerade zu stehen Mut notwendig ist.
Elena Tregubova ist mutig. Sie berichtet auch von Michail Chodorkowskij, der im Zuge des neuen Kapitalismus in Rußland mit seinem Ölkonzern Yukos zu einem mächtigen Mann aufstieg und unter Putin zu Fall und in ein sibirisches Lager gebracht wurde - angeblich weil er Steuern hinterzogen hat, nach Ansicht Elena Tregubovas aber (nicht nur nach ihrer Ansicht), weil er die Opposition finanziell unterstützte. "Im Grunde hat man Chodorkowskij dafür ins Gefängnis gesteckt, daß er mehr Verstand und Talent hatte als Putins Freunde und deshalb in den Jahren der Reformen ein wirtschaftlich arbeitendes, einträgliches Unternehmen aufbauen konnte, das nach der Übernahme wiederum den Putinfreunden gratis in den Schoß fiel." Der russische Staat funktioniere kooperativ. Zur Kooperation des Staates gehöre nur, wer loyal ihm gegenüber sei. Und was macht der freie Westen? "Das Schicksal von Yukos steht vor aller Augen. Der Exkanzler eines fremden Landes", schreibt Tregubova, "fügt sich in die Kooperation ein und wird, ,unser Mann in Europa'. Ein russischer Geschäftsmann dagege, der Milliarden von Dollar in den Staatshaushalt eingebracht hat, ,gehört nicht dazu' und wandert ins Gefängnis." Wird Chodorkowksij eine Zukunft haben? Elena Tregubova zweifelt daran: "Auch wenn Chodorkowskij in einem seiner offenen Briefe aus der Haft unlängst jeder Rache abgeschworen hat, fürchte ich ernsthaft, daß Putin ihn lebendig nicht gehen lassen wird."
Die Tageszeitung "Kommersant" hat der unbequemen Journalistin nach Erscheinen von "Geschichten eines Kreml-Diggers" gekündigt. Anfang 2004 detonierte eine Bombe vor der Tür der Wohnung, in der Elena Tregubova wohnt (F.A.Z. vom 4. Februar 2004). Auf den letzten Seiten ihres Mutanten-Buches schreibt sie: "Vielleicht werden gerade Sie, Frau Merkel, als erste unter den Regierenden die Kühnheit besitzen, Putin ernsthaft unliebsame Fragen zu stellen. Vielleicht werden gerade Sie mit ihrem weiblichen Verstand und Herzen erkennen, daß hinter solchen Fragen keine trockenen Prinzipien und keine abstrakten politischen Debatten stehen, sondern das reale Leben von Menschen, die genau in diesem Augenblick - gerade jetzt, während Sie dieses Buch lesen - in Rußland in Lebensgefahr schweben."
EBERHARD RATHGEB
Elena Tregubova: "Die Mutanten des Kreml". Mein Leben in Putins Reich. Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja und Franziska Zwerg. Tropen Verlag, Berlin 2006. 377 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




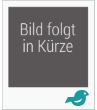

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.10.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.10.2006