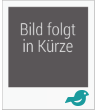Nicht lieferbar

Friedrich Blume
Gebundenes Buch
Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Sachteil, 9 Bde. u. Reg.-Bd.
Allgemeine Enzyklopädie der Musik
Mitwirkender: Blume, Friedrich / Herausgeber: Finscher, Ludwig
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




"Die Musik in Geschichte und Gegenwart", international als "MGG", bekannt und anerkannt, erscheint von 1994 bis 2004 in einer völlig neu bearbeiteten Ausgabe in zwei Teilen, einem Sachteil in zehn Bänden (inkl. Register) und einem Personenteil in achtzehn Bänden (inkl. Register). Über 1.500 Stichworte, zahlreiche Abbildungen, Zeichnungen und Faksimiles, Notenbeispiele und Druckproben aus alten Musikhandschriften, Tabellen und Diagramme
Produktdetails
- Verlag: Bärenreiter / J.B. Metzler
- 2., neubearb. Ausg.
- Deutsch
- Abmessung: 280mm
- Gewicht: 26011g
- ISBN-13: 9783476410009
- ISBN-10: 3476410005
- Artikelnr.: 22482004
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.12.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.12.1999Noch einmal mit Gewühl
In ihrer Jugend hat die MGG unter Musik nur das Hohe verstanden
Dieses sei wohl "der letzte Versuch gewesen, die Gesamtheit des musikalischen Wissens zusammenfassend darzustellen", formulierte Friedrich Blume, Herausgeber der ersten Ausgabe der Musikenzyklopädie "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (MGG) in deren letztem Band; angesichts zunehmend sich entwickelnder Sonderdisziplinen gehöre "die Zukunft dem Spezialnachschlagebuch". Und er stützte seine Zweifel mit der Feststellung, "es würde leicht nochmals eine Reihe von vierzehn Bänden ergeben, wenn das ganze Werk auf den neuesten Stand gebracht werden sollte". Genauso kommt es nun, und bei vierzehn Bänden wird es nicht bleiben. Wie um
In ihrer Jugend hat die MGG unter Musik nur das Hohe verstanden
Dieses sei wohl "der letzte Versuch gewesen, die Gesamtheit des musikalischen Wissens zusammenfassend darzustellen", formulierte Friedrich Blume, Herausgeber der ersten Ausgabe der Musikenzyklopädie "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (MGG) in deren letztem Band; angesichts zunehmend sich entwickelnder Sonderdisziplinen gehöre "die Zukunft dem Spezialnachschlagebuch". Und er stützte seine Zweifel mit der Feststellung, "es würde leicht nochmals eine Reihe von vierzehn Bänden ergeben, wenn das ganze Werk auf den neuesten Stand gebracht werden sollte". Genauso kommt es nun, und bei vierzehn Bänden wird es nicht bleiben. Wie um
Mehr anzeigen
zu beweisen, dass die Argumente des alten Herausgebers eher für als gegen eine Nachfolgerin sprachen, ging die Arbeit an der alten MGG ohne Unterbrechung in die an der neuen über; erst in den achtziger Jahren lag der Registerband der ersten Ausgabe vor, im Jahre 1994 der erste Band der zweiten. Deren Herausgeber, Ludwig Finscher, war mit wichtigen Beiträgen schon in jener vertreten, auch weitere Fachvertreter schrieben für beide.
Dass die zweite Ausgabe lediglich "neu bearbeitet" sein soll, ist aber eine arge Untertreibung. Nur selten zeigen in Klammern gesetzte Autorennamen an, dass der alte Artikel überarbeitet wurde; ein "SL" (= Schriftleitung) kündet davon, dass er nur aktualisiert worden ist. Nicht zu reden vom Äußeren - die neue MGG gibt sich leserfreundlicher. Sofern man nicht gerade etwas Bestimmtes im Auge hat, blättert und schmökert man in ihr lieber als in der alten.
Das ist Ausdruck eines anderen Konzepts von Wissenschaft, einer Öffnung zu neuen Fragestellungen und Arbeitsgebieten wie zu neuen Darstellungsformen, welche dem esoterischsten aller Orchideenfächer gut ansteht. Das erste Lob der neuen Ausgabe muss der Konsequenz gelten, mit der sie die mit der alten verbundenen Rechenschaften beantwortet - auch wenn sie den Artikel "Musikwissenschaft" ausspart. Zwischen der ersten Konzeption der alten Ausgabe (1942/43) und deren Abschluss lagen mehr als vierzig Jahre, innerhalb deren die Musikwissenschaft sich stärker wandelte als je zuvor. Dem konnte die alte Ausgabe nur selten Rechnung tragen, am ehesten noch in Prioritäten der Betrachtung und in der Diktion: Falls schon zwanzig Jahre früher im ersten Band fällig gewesen, wäre zum Beispiel der im vierzehnten Band stehende Artikel "Zwölftonmusik und serielle Musik" sehr anders ausgefallen. Wie viel größer nun aber, um im Sachgebiet zu bleiben, die Differenzen der fast ein Halbjahrhundert auseinander liegenden Behandlungen des Stichwortes "Atonalität".
Hinausgehend über das jeglicher kompilierenden Überschau eigene konservative Moment gab die Situation im und nach dem Krieg genug Anlass, altbewährte Maßgaben zu beachten - das festgefügte Bild der Musikgeschichte vertraten in der alten MGG die großen, viel beachteten Epochenartikel. Wohl findet man die einschlägigen Stichworte auch in der neuen, durchweg jedoch knapper behandelt, weil auf übergreifende Gesichtspunkte konzentriert, oft Konzepte und Kriterien der Epochengliederung selbst befragend. Derlei Orientierung auf eine Meta-Ebene beugt nicht nur der positivistischen Faktenhuberei vor (Aufzählungen begegnen erfreulich selten), sie befördert auch den Respekt der Autoren vor der Zuständigkeit sachlich benachbarter Stichworte. So findet man Überschneidungen in der in jedem Sinne bunteren neuen Ausgabe seltener als in der alten - umso erstaunlicher, als Ludwig Finscher die Autoren an längerer Leine laufen lässt als Friedrich Blume und den Unterschied enzyklopädischer und lexikalischer Darstellungsweise ausdrücklich betont: "Die Tendenz zur Darstellung übergreifender Zusammenhänge in ,sizeable essays' ist, wo immer das möglich und sinnvoll erscheint, verstärkt worden." Damit diese essayistische Ermunterung nicht allzu viele Grenzüberschreitungen auslöse, war bei der Auswahl der Stichwörter ebenso viel Aufmerksamkeit gefordert wie bei deren Bearbeitung.
Bei der Auswahl zeigt sich die neue MGG im besten Licht: Nicht nur macht sie dem Eurozentrismus der alten den Garaus - nahezu programmatisch entfällt im ersten Band das Stichwort "Abendland", wohingegen dessen umfangreichster Artikel "Afrika südlich der Sahara" behandelt; nicht nur sind "Aleatorik" oder "Cluster" mit eigenen Artikeln bedacht, erfährt "Serielle Musik" eine ausführliche Behandlung; nicht nur ist alles unterhalb der "Hochkunst" Liegende bis hin zu "Bänkelsang" stärker berücksichtigt. Dasselbe gilt für mittlerweile florierende Forschungszweige, unter anderem Musiksoziologie und Rezeptionsforschung. Stichworte wie "Historismus", "Klassizismus", "Politische Musik", "Zeichen" oder "Zeit" tauchten in der alten MGG nicht auf und sind nun mit ausgezeichneten Essays vertreten.
Dass die Auswahl der Stichwörter die Verzweigungen der Musikwissenschaft differenziert widerspiegelt, erleichtert die Benutzung nicht unbedingt und macht Querverweise unumgänglich; wer etwa im Anschluss an "Mittelalter" und "Burgund" gemäß alten Benennungen "Niederländische Musik" sucht, braucht eine Weile, ehe er sie - mit wie plausiblen Gründen auch immer - als "franko-flämische" behandelt findet. Freilich schafft sich das Unternehmen zugleich, jenen Verzweigungen nachgehend, besondere Aktivposten; gerade, wo es der akademischen Systematik ein Schnippchen schlägt, hat es Glück. Wohl ließen sich zum Beispiel "Gesamtkunstwerk" oder "Musikdrama" als Unterkapitel von "Oper" vorstellen, "Absolute Musik" (schon in der alten MGG) oder "Zeit" als Unterkapitel von "Musikästhetik", "L'homme armé" unter "cantus firmus", "Notes inégales" unter "Form" - doch erledigt sich die Frage bereits durch die Qualität der Behandlung.
Anders als die erste Ausgabe trennt die zweite Person und Sachen (der erste Band des Personenteils ist soeben erschienen). Dergestalt konnten innerhalb der kurzen Frist von nur fünf Jahren in den neun Bänden des Sachteils nahezu alle Konsequenzen der Ungleichzeitigkeit vermieden und fast eine "Momentaufnahme", auch des neuen, eigenen Profils gegeben werden. Auch erweitert sich der Abstand zu "The New Grove Dictionary of the Music and Musicians", mit dem MGG in kooperativem Wettbewerb steht, dessen erste Neubearbeitung (1980) zwischen die beiden deutschen Ausgaben fiel und dessen zweite bereits angekündigt ist. Diese Konstellation mag das Publikationstempo mitverschuldet haben, welches den hier fälligen Summierungen, von Verzweiflungen der Verantwortlichen abgesehen, selten gut bekommt; offenbar ist das Stichwort "Oper" dessen Opfer, die Stichworte "Deutschland" oder "Musikwissenschaft" mindestens zur Hälfte; im ersten Fall können dies auch die meist vorzüglichen Behandlungen der Einzelbereiche nicht ausgleichen.
Zwar wäre es angesichts des Gesamtumfangs töricht, nach Disproportionen und Fehlern zu jagen. Doch dass "Libretto" doppelt so viel Umfang beansprucht wie "Paris" und mehr als doppelt so viel wie "London", dass "Potsdam" oder "Chemnitz" gar nicht vertreten sind, lässt sich schwer einsehen; dass mitunter auf nicht vorhandene Abbildungen verwiesen, Siegfried Kurz zu "Siegfried Knie" wird, die Kunsthistorikerin Karin von Maur sich der Musikwelt unter dem Namen "Masur" einverleibt findet und der Verfasser des wichtigen Artikels "Notre Dame und Notre-Dame-Handschriften" ungenannt bleibt, verrät mehr heiße Nadel, als einem Unternehmen wie diesem ansteht.
Zur "Offenheit" gehört, dass Standpunkte, Schreibweisen und auch Niveaus kräftig differieren - fast wie eine Enzyklopädie in der Enzyklopädie führen das im sechsten Band die 1200 Spalten vor, auf denen zwischen "Music hall" und "Musique concrète" alle vom Wort "Musik" ausgehenden Stichwörter versammelt sind. Dennoch sollte auch ein erklärtermaßen toleranter Pluralismus pauschalierende Formulierungen wie die vom "Bestreben der SED, die bürgerliche Kultur in Dresden zu zerstören", ebenso vermeiden wie die einseitige Auskunft, dass die "Musikwissenschaft im Osten Deutschlands . . . in offener Negation oder in geheimer Affirmation stets auf die Musikwissenschaft der BRD bezogen blieb". Es gab auch das Umgekehrte; manche Selbstverständigungen der westdeutschen Musikwissenschaft sind ohne den Stachel der vom Osten aus - wenngleich oft einseitig - gestellten Grundsatzfragen schwer denkbar. Ludwig Finscher mag das bedacht haben, als er den neunzigjährigen Georg Knepler einlud, das Thema "Musikgeschichtsschreibung" zu übernehmen.
Der neu vorgelegte Sachteil der MGG hat jedenfalls die Zweifel des alten Herausgebers an den Chancen weiterer enzyklopädischer Unternehmungen weniger zerstreut, als sie und ihre Begründungen in die Konzeption hineingezogen. Besseres lässt sich von dem Unternehmen kaum sagen.
PETER GÜLKE
"Die Musik in Geschichte und Gegenwart". Allgemeine Enzyklopädie der Musik, begründet von Friedrich Blume. Zweite, neu bearbeitete Ausgabe, herausgegeben von Ludwig Finscher. Sachteil. 9 Bände und Registerband, inkl. CD-ROM. Bärenreiter Verlag, Kassel, Metzler Verlag, Stuttgart 1994-98. 7040 S., geb., zus. 3980,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Dass die zweite Ausgabe lediglich "neu bearbeitet" sein soll, ist aber eine arge Untertreibung. Nur selten zeigen in Klammern gesetzte Autorennamen an, dass der alte Artikel überarbeitet wurde; ein "SL" (= Schriftleitung) kündet davon, dass er nur aktualisiert worden ist. Nicht zu reden vom Äußeren - die neue MGG gibt sich leserfreundlicher. Sofern man nicht gerade etwas Bestimmtes im Auge hat, blättert und schmökert man in ihr lieber als in der alten.
Das ist Ausdruck eines anderen Konzepts von Wissenschaft, einer Öffnung zu neuen Fragestellungen und Arbeitsgebieten wie zu neuen Darstellungsformen, welche dem esoterischsten aller Orchideenfächer gut ansteht. Das erste Lob der neuen Ausgabe muss der Konsequenz gelten, mit der sie die mit der alten verbundenen Rechenschaften beantwortet - auch wenn sie den Artikel "Musikwissenschaft" ausspart. Zwischen der ersten Konzeption der alten Ausgabe (1942/43) und deren Abschluss lagen mehr als vierzig Jahre, innerhalb deren die Musikwissenschaft sich stärker wandelte als je zuvor. Dem konnte die alte Ausgabe nur selten Rechnung tragen, am ehesten noch in Prioritäten der Betrachtung und in der Diktion: Falls schon zwanzig Jahre früher im ersten Band fällig gewesen, wäre zum Beispiel der im vierzehnten Band stehende Artikel "Zwölftonmusik und serielle Musik" sehr anders ausgefallen. Wie viel größer nun aber, um im Sachgebiet zu bleiben, die Differenzen der fast ein Halbjahrhundert auseinander liegenden Behandlungen des Stichwortes "Atonalität".
Hinausgehend über das jeglicher kompilierenden Überschau eigene konservative Moment gab die Situation im und nach dem Krieg genug Anlass, altbewährte Maßgaben zu beachten - das festgefügte Bild der Musikgeschichte vertraten in der alten MGG die großen, viel beachteten Epochenartikel. Wohl findet man die einschlägigen Stichworte auch in der neuen, durchweg jedoch knapper behandelt, weil auf übergreifende Gesichtspunkte konzentriert, oft Konzepte und Kriterien der Epochengliederung selbst befragend. Derlei Orientierung auf eine Meta-Ebene beugt nicht nur der positivistischen Faktenhuberei vor (Aufzählungen begegnen erfreulich selten), sie befördert auch den Respekt der Autoren vor der Zuständigkeit sachlich benachbarter Stichworte. So findet man Überschneidungen in der in jedem Sinne bunteren neuen Ausgabe seltener als in der alten - umso erstaunlicher, als Ludwig Finscher die Autoren an längerer Leine laufen lässt als Friedrich Blume und den Unterschied enzyklopädischer und lexikalischer Darstellungsweise ausdrücklich betont: "Die Tendenz zur Darstellung übergreifender Zusammenhänge in ,sizeable essays' ist, wo immer das möglich und sinnvoll erscheint, verstärkt worden." Damit diese essayistische Ermunterung nicht allzu viele Grenzüberschreitungen auslöse, war bei der Auswahl der Stichwörter ebenso viel Aufmerksamkeit gefordert wie bei deren Bearbeitung.
Bei der Auswahl zeigt sich die neue MGG im besten Licht: Nicht nur macht sie dem Eurozentrismus der alten den Garaus - nahezu programmatisch entfällt im ersten Band das Stichwort "Abendland", wohingegen dessen umfangreichster Artikel "Afrika südlich der Sahara" behandelt; nicht nur sind "Aleatorik" oder "Cluster" mit eigenen Artikeln bedacht, erfährt "Serielle Musik" eine ausführliche Behandlung; nicht nur ist alles unterhalb der "Hochkunst" Liegende bis hin zu "Bänkelsang" stärker berücksichtigt. Dasselbe gilt für mittlerweile florierende Forschungszweige, unter anderem Musiksoziologie und Rezeptionsforschung. Stichworte wie "Historismus", "Klassizismus", "Politische Musik", "Zeichen" oder "Zeit" tauchten in der alten MGG nicht auf und sind nun mit ausgezeichneten Essays vertreten.
Dass die Auswahl der Stichwörter die Verzweigungen der Musikwissenschaft differenziert widerspiegelt, erleichtert die Benutzung nicht unbedingt und macht Querverweise unumgänglich; wer etwa im Anschluss an "Mittelalter" und "Burgund" gemäß alten Benennungen "Niederländische Musik" sucht, braucht eine Weile, ehe er sie - mit wie plausiblen Gründen auch immer - als "franko-flämische" behandelt findet. Freilich schafft sich das Unternehmen zugleich, jenen Verzweigungen nachgehend, besondere Aktivposten; gerade, wo es der akademischen Systematik ein Schnippchen schlägt, hat es Glück. Wohl ließen sich zum Beispiel "Gesamtkunstwerk" oder "Musikdrama" als Unterkapitel von "Oper" vorstellen, "Absolute Musik" (schon in der alten MGG) oder "Zeit" als Unterkapitel von "Musikästhetik", "L'homme armé" unter "cantus firmus", "Notes inégales" unter "Form" - doch erledigt sich die Frage bereits durch die Qualität der Behandlung.
Anders als die erste Ausgabe trennt die zweite Person und Sachen (der erste Band des Personenteils ist soeben erschienen). Dergestalt konnten innerhalb der kurzen Frist von nur fünf Jahren in den neun Bänden des Sachteils nahezu alle Konsequenzen der Ungleichzeitigkeit vermieden und fast eine "Momentaufnahme", auch des neuen, eigenen Profils gegeben werden. Auch erweitert sich der Abstand zu "The New Grove Dictionary of the Music and Musicians", mit dem MGG in kooperativem Wettbewerb steht, dessen erste Neubearbeitung (1980) zwischen die beiden deutschen Ausgaben fiel und dessen zweite bereits angekündigt ist. Diese Konstellation mag das Publikationstempo mitverschuldet haben, welches den hier fälligen Summierungen, von Verzweiflungen der Verantwortlichen abgesehen, selten gut bekommt; offenbar ist das Stichwort "Oper" dessen Opfer, die Stichworte "Deutschland" oder "Musikwissenschaft" mindestens zur Hälfte; im ersten Fall können dies auch die meist vorzüglichen Behandlungen der Einzelbereiche nicht ausgleichen.
Zwar wäre es angesichts des Gesamtumfangs töricht, nach Disproportionen und Fehlern zu jagen. Doch dass "Libretto" doppelt so viel Umfang beansprucht wie "Paris" und mehr als doppelt so viel wie "London", dass "Potsdam" oder "Chemnitz" gar nicht vertreten sind, lässt sich schwer einsehen; dass mitunter auf nicht vorhandene Abbildungen verwiesen, Siegfried Kurz zu "Siegfried Knie" wird, die Kunsthistorikerin Karin von Maur sich der Musikwelt unter dem Namen "Masur" einverleibt findet und der Verfasser des wichtigen Artikels "Notre Dame und Notre-Dame-Handschriften" ungenannt bleibt, verrät mehr heiße Nadel, als einem Unternehmen wie diesem ansteht.
Zur "Offenheit" gehört, dass Standpunkte, Schreibweisen und auch Niveaus kräftig differieren - fast wie eine Enzyklopädie in der Enzyklopädie führen das im sechsten Band die 1200 Spalten vor, auf denen zwischen "Music hall" und "Musique concrète" alle vom Wort "Musik" ausgehenden Stichwörter versammelt sind. Dennoch sollte auch ein erklärtermaßen toleranter Pluralismus pauschalierende Formulierungen wie die vom "Bestreben der SED, die bürgerliche Kultur in Dresden zu zerstören", ebenso vermeiden wie die einseitige Auskunft, dass die "Musikwissenschaft im Osten Deutschlands . . . in offener Negation oder in geheimer Affirmation stets auf die Musikwissenschaft der BRD bezogen blieb". Es gab auch das Umgekehrte; manche Selbstverständigungen der westdeutschen Musikwissenschaft sind ohne den Stachel der vom Osten aus - wenngleich oft einseitig - gestellten Grundsatzfragen schwer denkbar. Ludwig Finscher mag das bedacht haben, als er den neunzigjährigen Georg Knepler einlud, das Thema "Musikgeschichtsschreibung" zu übernehmen.
Der neu vorgelegte Sachteil der MGG hat jedenfalls die Zweifel des alten Herausgebers an den Chancen weiterer enzyklopädischer Unternehmungen weniger zerstreut, als sie und ihre Begründungen in die Konzeption hineingezogen. Besseres lässt sich von dem Unternehmen kaum sagen.
PETER GÜLKE
"Die Musik in Geschichte und Gegenwart". Allgemeine Enzyklopädie der Musik, begründet von Friedrich Blume. Zweite, neu bearbeitete Ausgabe, herausgegeben von Ludwig Finscher. Sachteil. 9 Bände und Registerband, inkl. CD-ROM. Bärenreiter Verlag, Kassel, Metzler Verlag, Stuttgart 1994-98. 7040 S., geb., zus. 3980,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Eine Enzyklopädie des geballten Wissens. Weltweit beispiellos." (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)' "Eine Enzyklopädie, die sich am Puls des Gegenstandes und der Zeit befindet." (Neue Zürcher Zeitung)
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben