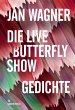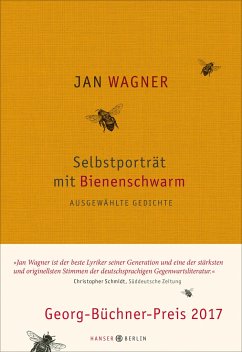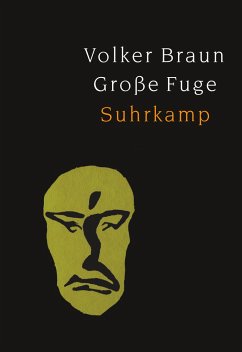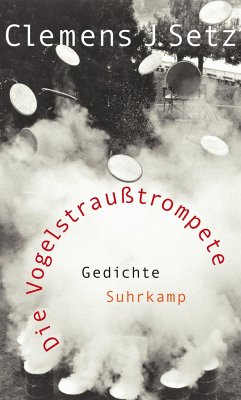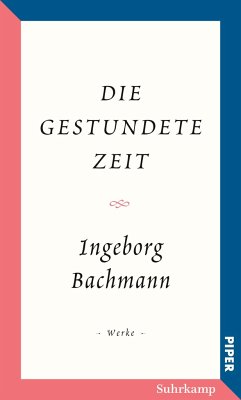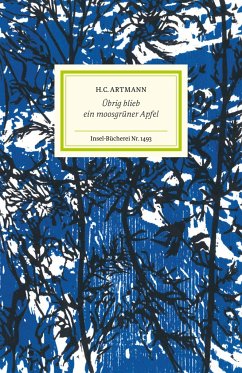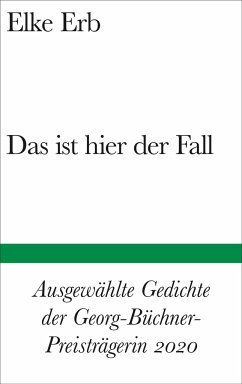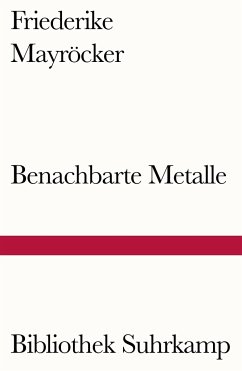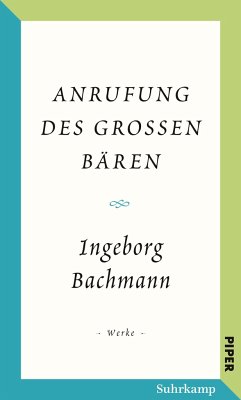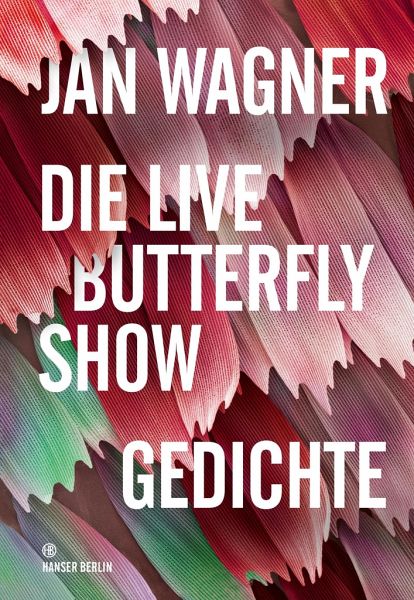
Die Live Butterfly Show

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Schmetterlinge, die Jan Wagner in diesem Gedichtband aus dem Netz holt und Loopings fliegen lässt, können auch Münchner Krähen sein, Marder im Blutrausch oder ein Biker aus Montana. Entscheidend ist: Sie fliegen. Welchen Gegenstand, welches Wesen Jan Wagner auch einfängt und poetisch verwandelt, er hebt damit die Gesetze der Schwerkraft auf - selbst die vielfach ummauerte Verbotene Stadt gerät ins Schweben, und unsere Wahrnehmung, unser Denken verlieren mit jedem gelesenen Vers an Trägheit. Mit jedem Band dagegen scheint Jan Wagner an Souveränität zu gewinnen, seine Formenvirtuosi...
Die Schmetterlinge, die Jan Wagner in diesem Gedichtband aus dem Netz holt und Loopings fliegen lässt, können auch Münchner Krähen sein, Marder im Blutrausch oder ein Biker aus Montana. Entscheidend ist: Sie fliegen. Welchen Gegenstand, welches Wesen Jan Wagner auch einfängt und poetisch verwandelt, er hebt damit die Gesetze der Schwerkraft auf - selbst die vielfach ummauerte Verbotene Stadt gerät ins Schweben, und unsere Wahrnehmung, unser Denken verlieren mit jedem gelesenen Vers an Trägheit. Mit jedem Band dagegen scheint Jan Wagner an Souveränität zu gewinnen, seine Formenvirtuosität zeigt sich in der "Live Butterfly Show" als unbekümmerte Lust an der Freiheit in der Form, am Klang, die großen Spaß macht.