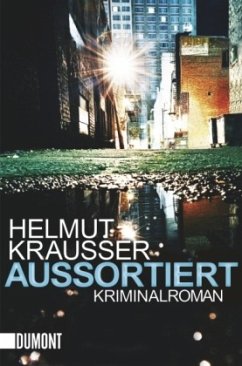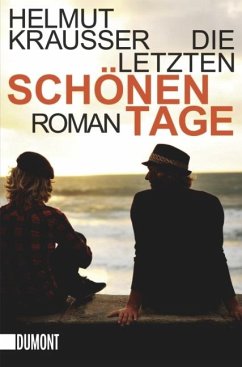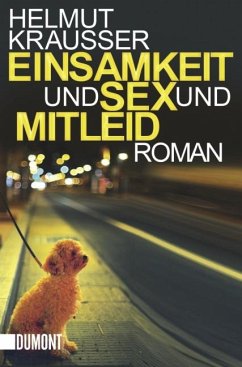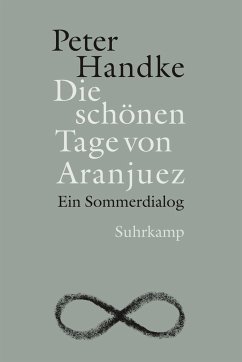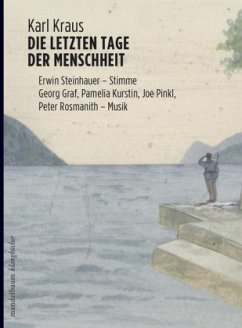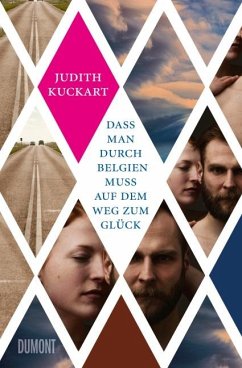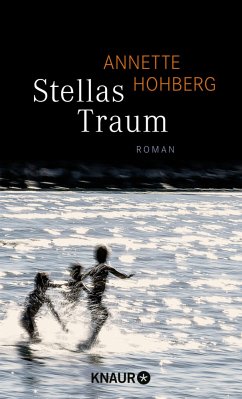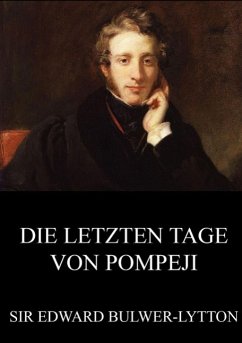feiern darf, ja feiern muss. Vielleicht liegt es daran, dass Krausser Eigenschaften in sich vereint, die hierzulande eher selten und erst recht nicht derart geballt auftreten, eine Art dostojewskihaftes Berserkertum, gepaart mit einer oft übersehenen, angelsächsisch geschulten Ironie und Leidensfähigkeit, die den Romantiker verrät und an deren Wahrhaftigkeit weder die Sprachlust am Pathos noch die vom Autor gut und gern eingenommene Pose des Lässig-Ungerührten einen Zweifel lässt. Krausser schreibt mit dem heißen Herz eines Dramatikers und der kühlen Hand eines Königsmörders - und noch dazu sehr viel. Kaum hatte man ein Werk wie "Einsamkeit und Sex und Mitleid" (2009) verdaut, für das eigentlich ein Preis für den besten Romantitel hätte ausgelobt werden müssen, folgte im vergangenen Frühjahr mit "Substanz" ein Destillat seiner Tagebücher und damit eine Riesendosis Ego. Jetzt also der Roman "Die letzten schönen Tage", sein zwölfter. Er zeigt Helmut Krausser in Hochform, nah an unserer Gegenwart, ihren Fragen und ihrer Sprache.
Es ist ein Roman in Geschichten, die ineinandergreifen wie Finger um einen Hals, bevor sie langsam zudrücken. Nichts ist, wie es scheint. Die Sexspiele, zu denen betrunkene Jungs zu Beginn ein Mädchen namens Becky nötigen, sind alles andere als harmlos; der Florida-Urlaub zweier pensionierter Berliner Lehrerinnen, gedacht als eine Art Flitterwochen für die erotische Steigerung ihrer alten Freundschaft, wird zum Machtkampf um Behauptung und Unterwerfung. Die Dreiecksbeziehung zwischen Kati, Serge und David, die im Zentrum des Romans steht, kreist derweil um Formen von Abhängigkeit. Und süchtig ist natürlich auch das deutsche Spielerpärchen auf Malta, in deren Wohnung sich die von Krausser ausgelegte Schlinge schließlich zuzieht - jedenfalls fast. Der Einzige, der seiner Abhängigkeit entkommt, ist der Kater Johnson, der während der Abwesenheit seiner Herrin (ebenjener Jule, die mit ihrer Freundin nach Florida fährt) in der Obhut ihres Sohnes (jenes David, mit dem Kati Serge betrügt) das Fressen einstellt und so "auf klassisch römische Art Suizid begeht". Von Kraussers höherer Ironie war ja bereits die Rede.
Zu den vielen Überraschungen, die dieser Roman bietet, gehört, dass sich als stärkste Figur ausgerechnet jene entpuppt, die man zunächst für die schwächste hält. Denn an Kati lässt sich zunächst einmal vor allem das alte weibliche Rätsel studieren, warum eine gesunde, normale, freundliche Frau mit einem Mann zusammenbleibt, der das alles offensichtlich nicht ist. Der Glaube, gebraucht zu werden, wie so oft eine Mischung aus Erpressung auf der einen und Illusion auf der anderen Seite, lässt sie über solche Vorfälle hinwegsehen wie den, dass Serge einmal in Venedig Lust hatte, sie in den Kanal zu stoßen - was er dann zwar nicht getan, wovon er ihr aber trotzdem erzählt hat. Serge ist ein creep wie das Muttersöhnchen in Hitchcocks "Psycho", misstrauisch und verschlossen, der seine Versagensängste in der manischen Beobachtung anderer betäubt. Trotzdem merkt er erst, als die Affäre schon vorbei ist, dass seine Freundin ihn betrogen hat - mit seinem selbstbewussten, smarten und dabei gutartigen Arbeitskollegen David, der bis in Katis Bett hinein alles ist, was Serge nicht ist. In Kapiteln, die jeweils aus der Sicht der einzelnen Charaktere geschrieben sind, bei Kati und Serge durch die Ich-Form verstärkt, schildert Krausser eine immer klaustrophobischer werdende Beziehung. Wie alle Figuren des Romans erliegen auch Kati und Serge der Illusion, dass sie die Gewalten, denen sie unterworfen sind, durchschauen und damit beherrschen könnten. Ein Rest Unsicherheit bleibt. Denn "wenn man jemanden liebt, dann ist doch alles möglich, oder nicht?"
Der Roman lässt sich auf vielen Ebenen lesen; alle sind beunruhigend. Daran, wie sehr sie es sind, zeigt sich die Könnerschaft Kraussers, der hier mit sprachlicher Direktheit und dramaturgischer Finesse Geschichten um das Psychogramm einer sich allmählich offenbarenden Schizophrenie rankt. Es sind eben nicht nur die kleinen Abweichungen, die chaostheoretisch den Lauf der Dinge ändern können, sondern bisweilen setzt gerade das Ausbleiben solcher Abweichungen eine Kette von Ereignissen in Gang - wie etwa Serges Entschluss, den Glückscent auf den Bahnschienen nicht aufzuheben.
Das alles ist ganz dicht und doch subtil am Berlin der letzten Monate entlang geschrieben. So bemerkt David einmal, ins Berghain könne man nicht mehr gehen, "das war inzwischen zu berühmt und voller Touristen", ohne dass der Grund dafür eigens benannt werden müsste. Der Roman mündet in die Februar-Gegenwart des Lesers. Wie Krausser diese Wintertage auf Malta, in Berlin und Toronto, die wie alles Schreckliche nur im Nachhinein, eben in der "Rücksicht auf eine Zukunft", dann doch schön erscheinen können, mal dehnt und mal beschleunigt, wie er die Zeit und ihr Vergehen immerfort unaufdringlich thematisiert, das gibt dem Roman seine eigentliche Form. Am Schluss sitzt man mit David am Meer und staunt, "wie beständig, wie ungemein beharrlich die Gischt gegen die Felsen klatscht" - und wie überzeugend Helmut Krausser davon erzählt.
Helmut Krausser: "Die letzten schönen Tage".
Roman.
Dumont Buchverlag, Köln 2011. 223 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
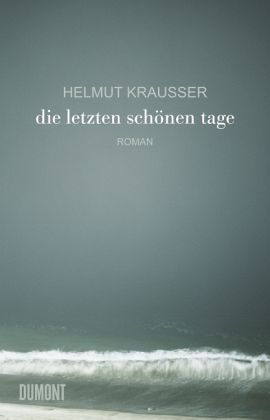





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.02.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.02.2011