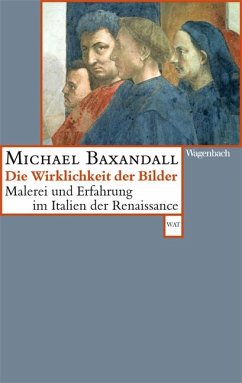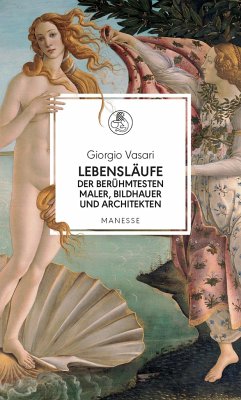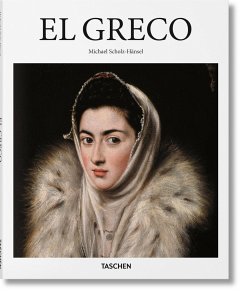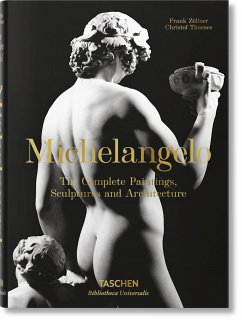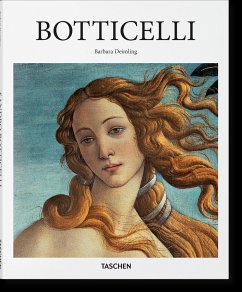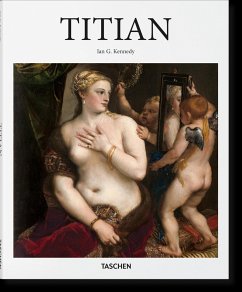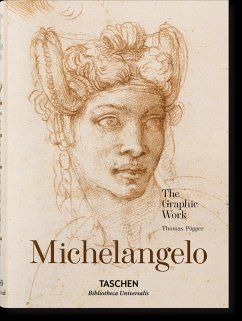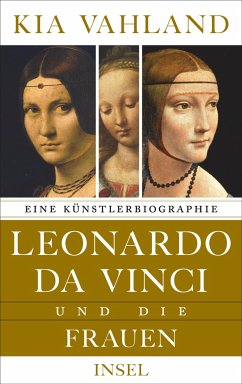hatten. Aus Boccaccios freizügigen Novellen wissen wir, dass das spätmittelalterliche, von den Zünften regierte Florenz schon um 1350 eine schlagfertige Diskussionskultur besaß.
Am Anfang eines bemerkenswert schön gestalteten Bandes erinnert nun Heinz Georg Held daran, dass Leon Battista Alberti, Begründer der Kunsttheorie der Renaissance, die Maler ermuntert hatte, das Gespräch unter ihresgleichen und mit dem kunstsinnigen Publikum zu suchen. Der in Pavia lehrende Held will das "kontroverse Kunstgespräch" der italienischen Renaissance rekonstruieren. Deren Kultur des Dialogs sei in der Forschung durch die hochkarätige Kunstheorie der Zeit in den Hintergrund gedrängt worden.
In seiner kenntnisreichen Auswahl von Quellentexten greift Held denn auch auf unterschiedlichste Gattungen zurück. Er bringt zentrale Autoren der Frührenaissance, Texte aus dem Umfeld der Meister der Hochrenaissance und wichtige, teils wenig bekannte Positionen des Manierismus und der Gegenreformation. Seine Auswahl belegt, dass es zur Zeit der Formierung der normativen Kunsttheorie Leon Battista Albertis, in der ersten Hälfte des Quattrocento, einen vielstimmigen, von kirchlichen Verboten weitgehend freie Kunstdiskurs gab, auch im Austausch zwischen Florenz und Byzanz, wie eindrucksvolle Briefe des Manuel Chrysoloras belegen. Zum anderen spannt Held den Bogen einer klassischen, großen Erzählung: von der Emanzipation der Künstler und ihrer neuen Freiheit der Themenwahl bis zur neuerlichen Herrschaft der Zeloten und Fundamentalisten in der Gegenreformation. Er beruft sich dabei auf die Großmeister Jacob Burckhardt und Johan Huizinga, des Letzteren gegenläufige These von der Renaissance als Herbst des Mittelalters er allerdings nicht erwähnt. Die Verstreutheit der Quellen stellt eine anspruchsvolle Aufgabe an Belesenheit und Prägnanz der Auswahl.
Dass Held mit einem Kunstgespräch zwischen Vergil und Dante aus dessen "Göttlicher Komödie" beginnt, garantiert einen fulminanten Einstieg. Was allerdings Petrarcas berühmter Brief über die Besteigung des Mont Ventoux zu dem Dialog über die Kunst beitragen soll, bleibt offen. Sicherlich geht es hier um den Genuss am Sehen, wie Petrarca betont, aber nicht um Sprechen über Kunst. Es folgen wichtige und teils wenig bekannte Quellen aus dem fünfzehnten Jahrhundert.
Prägnant kontextualisiert Held etwa den Briefwechsel der willensstarken Sammlerin Isabella d'Este mit ihren venezianischen Agenten über die Bestellung eines Gemäldes bei dem geizigen und widerspenstigen Maler Giovanni Bellini. Überhaupt handelt es sich nicht um eine kommentierte Anthologie von originalen Quellentexten (wie sie Ulrich Pfisterer bereits vor zehn Jahren vorlegte). Held fasst die Texte und ihre Kontexte in einundzwanzig konzisen Kurzkapiteln zusammen. Jedes Kapitel enthält zudem wichtige, oft wuchtige Zitate. Helds Zusammenfassung des minutiös dokumentierten Gespräches zwischen einem Kollegium von Inquisitoren und dem selbstbewussten Maler Paolo Veronese aus dem Jahr 1573 markiert einen Höhepunkt und fast auch den Schlusspunkt des Buches. In diesem Verhör griff der angeklagte Maler auf die Kunst des Kunstgesprächs zurück: Dem Inquisitor gab er listig zu bedenken, dass seine, Veroneses, Vorbilder, die er gläubig nachahme, sich im Vatikan und in der Sixtinischen Kapelle des Papstes befänden.
Held hegte offenbar die Absicht, die wichtigsten Positionen der Kunstliteratur der italienischen Renaissance überhaupt vorzustellen - unabhängig davon, ob die Texte in Gesprächsform gehalten sind. Dies lässt ihn zentrale Autoren wie den Philosophen Nikolaus von Kues, den uomo universale Leonardo und den gegenreformatorischen Polemiker Andrea Gilio berücksichtigen - aber um den Preis, das Texte aufgenommen werden, die keine Gespräche wiedergeben. Und Held zählt offenbar bereits den Brief zu den literarischen Formen des Dialoges, nicht erst den Briefwechsel.
Eine stärkere Konzentration auf das selbstgewählte Thema hätte dem Buch genutzt. So hat Alberti in seinen dunklen Dialogen und in seinem bizarren Roman "Momus", der noch von Franz Kafka aufgegriffen wurde, brisante und höchst lesenswerte Gespräche über Kunst und Architektur ersonnen, die Held nicht berücksichtigt. Dass zwar Briefe des berüchtigten Schandmauls Pietro Aretino an Michelangelo abgedruckt werden, nicht aber dessen sarkastische Replik vom 20. November 1537 "an den göttlichen Aretino" ist ebenso schade wie das Fehlen des weit dialogischeren Briefwechsels Michelangelos mit Vittoria Colonna.
Bedauerlich ist es, dass der Autor auf Wiedergabe und Kommentierung jener pointierten Gespräche verzichtet, die Vasari in seine Künstlerviten einstreut. So fehlt etwa dessen denkwürdiger "Bericht" über einen Austausch Leonardos mit dem Herrscher Mailands. Mit den Vorwürfen eines ignoranten Priors über Leonardos Müßiggang und lange Pausen bei der Arbeit an seinem Abendmahl konfrontiert, erklärte der Maler zum Vergnügen des Herzogs, dass "schöpferische Menschen sich gerade dann am meisten mühen, wenn sie nicht arbeiten".
Dem Buch Helds wäre zu wünschen gewesen, wenn der Autor die von ihm etwas despektierlich erwähnten Fachdiskussionen stärker beachtet hätte. Dass sich die Leichtigkeit der Feder mit der Berücksichtigung der Diskussionen der Kenner verträgt, machen im Verlag Wagenbach die sechsundvierzig Bände der Vasari-Edition durch Übersetzung und Kommentarteil maßstabsetzend klar. Bei Held hingegen sind die Literaturhinweise zu den einzelnen Protagonisten der Kunstgespräche arg knapp geraten.
GERD BLUM
Heinz Georg Held: "Die Leichtigkeit der Pinsel und Federn".
Italienische Kunstgespräche der Renaissance. Eine Anleitung zur Bildbetrachtung in 21 Dialogen. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2016. 225 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
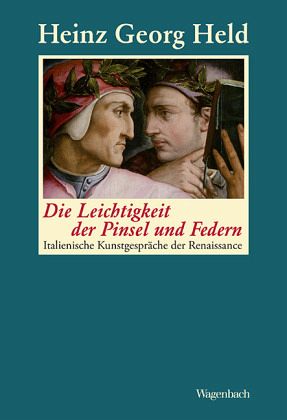




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.07.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.07.2016