mißlicher Umstand, mit dem Eckart Kleßmann und Rüdiger Safranski, Hoffmanns große Biographen der achtziger Jahre, auf je eigene Weise umgegangen sind.
Hartmut Steinecke, der bereits 1997 eine Einführung zu Hoffmann vorgelegt hat und als Mitherausgeber der Werkausgabe des Deutschen Klassiker Verlags einschlägig als Experte ausgewiesen ist, umgeht dieses Problem, indem er den nahezu ausschließlichen Akzent auf das Werk legt. Fast zwei Drittel seiner Darstellung gelten den letzten acht Jahren E. T. A. Hoffmanns und hangeln sich chronologisch von Werk zu Werk. Insofern ist der Untertitel des Buches mißverständlich: Geboten wird keine Zusammenschau von "Leben und Werk", sondern eher eine sich an ein breiteres Publikum wendende Werkmonographie, in der Biographisches eine allenfalls rudimentäre Rolle spielt.
Damit vermeidet es Steinecke zwar, Hoffmanns Texte vornehmlich als Ausdruck seiner Weltanschauung zu lesen, was die Schwäche von Kleßmanns Biographie war, oder altbekannte Klischees fortzuschreiben - wie die Überbetonung des oft Biographen wie Schriftsteller gleichermaßen affizierenden Bamberger Julia-Erlebnisses -, aber vergibt zugleich die Chance, dem Menschen E. T. A. Hoffmann näherzukommen. Was ist das für einer, der als Assessor in Posen Karikaturen auf die Spitzen der Gesellschaft in Umlauf setzt, als gelernter Jurist Musikdirektorstellen in Bamberg und Dresden antritt, seiner vierzehnjährigen Klavierschülerin Julia Mark hinterherschwärmt oder in seinen Werken die nächtlichen, abgründigen, dämonischen Seiten der menschlichen Existenz auslotet? Diese Frage muß ein Biograph jenseits von Sensationslüsternheit oder spekulativem Psychologisieren anders als ein Literaturwissenschaftler durchaus zu beantworten suchen.
Fantasie und Humor sind die beiden Leitbegriffe Steineckes bei der Analyse von Hoffmanns Werken. Als Dichter des Fantastischen beginnt er seine Laufbahn, wie sich schon im Titel seiner ersten Erzählsammlung, der "Fantasiestücke in Callot's Manier" (1813/14), niederschlägt, und die Fantasie sieht Steinecke auch als zentrale Kategorie für sein Erstlingswerk "Ritter Gluck" (1809) an. Bereits hier sei das Fantastische, über die Frühromantik hinausgehend, eng mit der zeitgenössischen Realität, der modernen Großstadt, verknüpft, und schon hier mache Hoffmann deutlich, daß sie ihre Ergänzung und ihr Widerlager in Form der "Besonnenheit" braucht. Bleibt das Fantastische ein durchgehender Zug von Hoffmanns Werk, so sieht Steinecke den Humor als Spezifikum seiner späten Texte an, sei es in Form eines verwirrenden Capriccios wie im Falle des "Roman-Märchens" "Prinzessin Brambilla" (1820) oder sei es in Form der kontrastästhetischen Konfiguration des letzten Romans, "Lebens-Ansichten des Katers Murr" (1819/21).
Einen besonderen Akzent legt Steinecke auf die vielfach unterschätzten oder mißbilligten, auch von der Forschung stets vernachlässigten späten Erzählungen E. T. A. Hoffmanns, wie etwa "Der Elementargeist" oder "Die Doppeltgänger" (beide 1821). Er nimmt sie vor dem Vorwurf, übereilt geschrieben und eklektizistisch beziehungsweise formelhaft komponiert zu sein, in Schutz und stellt dabei besonders ihre Form in den Mittelpunkt der Analysen. Diese lasse oftmals ein raffiniertes und wohlüberlegtes, häufig selbstreferentielles literarisches Spiel erkennen und könne einem betulichen oder klischeehaften Inhalt durchaus zuwiderlaufen. Eine Annäherung des späten Hoffmann an biedermeierliche oder frührealistische Tendenzen, wie es eine beliebte These der älteren, speziell der DDR-Forschung war, wobei insbesondere die kurz vor seinem Tod entstandene Erzählung "Des Vetters Eckfenster" (1822) als eine Art Vermächtnis gelesen wurde, sieht Steinecke nicht.
Sein Verfahren, jedem der über fünfzig Texte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und sie eigens zu würdigen, macht seine Darstellung zwar zu einem nützlichen Handbuch für jeden am Werk Interessierten, ist aber weder besonders leserfreundlich noch erkenntnisfördernd. Die großen Zusammenhänge gehen auf diese Weise eher verloren, und wer sich die Kompliziertheit der Hoffmannschen Plots vor Augen hält, kann leicht nachvollziehen, daß über weite Strecken schlichtweg Inhalt referiert werden muß. Statt akribischer, stets um ein ausgewogenes Urteil bemühter Einzelanalysen, die den Laien ermüden und dem Experten selten Spektakuläres offerieren, hätte man sich oftmals forciertere Thesen, thematische Bündelungen oder diskursive Erörterungen gewünscht, so beispielsweise zu Hoffmann als Leser, zu seiner philosophischen und naturwissenschaftlichen Bildung, zum Zusammenhang seines Werks mit der Literatur der Zeit oder zu seiner Arbeitsweise und "Figurenwerkstatt".
Daß Steinecke allerdings auch den Zeichner beziehungsweise Maler, den Komponisten wie Musikkritiker und schließlich den Juristen E. T. A. Hoffmann ausgiebig würdigt, spricht für sein Buch und seinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und so sind nicht zuletzt dessen Abbildungen hervorzuheben, die nicht nur Hoffmanns berühmte Zeichnungen wie die Titelvignetten zu "Meister Floh" und "Kater Murr" oder seine Darstellung des Kapellmeisters Kreisler, sondern auch seine wenig bekannten frühen Versuche als Maler wiedergeben.
THOMAS MEISSNER
Hartmut Steinecke: "Die Kunst der Fantasie". E. T. A. Hoffmanns Leben und Werk. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2004. 645 S., geb., 32,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
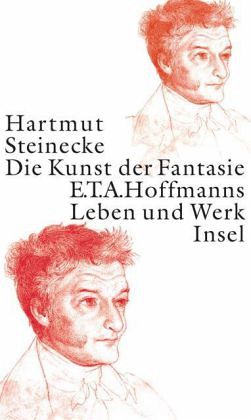




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.02.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.02.2005