sagen, daß Kirch kleinlich war: Immerhin hatte Kohl dem Medienmogul während seiner Amtszeit manches Geschäft durch seine Ahnungslosigkeit vermasselt. Behauptete zumindest Kirch, als die geplante Fusion seines Senders Premiere mit Bertelsmann gerade am Veto der Europäischen Union gescheitert war. Kohl habe ihm gesagt, davon verstehe er überhaupt nichts, habe aber dennoch beim Wettbewerbskommissar Karel Van Miert angerufen, und dadurch sei das Geschäft geplatzt. Plötzlich wird einem klar, warum der Vertrag von 1999 so wenige konkrete Pflichten für Helmut Kohl vorsah und ihm nicht eine Untergrenze, sondern eine Höchstgrenze an "Standard-Beratungen" setzte: nicht mehr als zwölf pro Jahr. Kirch wollte sich wohl vor zuviel unerwünschter Hilfe schützen.
Paragraph vier der Vereinbarung regelte deren Geheimhaltung. Wie das Papier, dessen Existenz in diesem Frühjahr hohe Wellen schlug, trotzdem in den Besitz von Hans Leyendecker gelangte, ist unbekannt. Jetzt bringt er es jedenfalls erstmals in vollem Wortlaut zum Abdruck: in seinem neuen Buch "Die Korruptionsfalle". Darin widmet sich Leyendecker, leitender poltischer Redakteur der "Süddeutschen Zeitung" und einer der profiliertesten investigativen Journalisten, der Bestechlichkeit in Deutschland. Und dabei interessieren ihn weniger die Skandale als deren Rezeption: "Entscheidend für den Befund über politische Sitten und Kuktur ist ihre gesellschaftliche Verarbeitung." Es wird Leyendecker, diesen hartnäckigen Rechercheur, deshalb fuchsen, daß Kohls großzügige Alimentierung durch Kirch schon wieder in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Deshalb kommt sein Buch zur rechten Zeit.
Es ist mit heißer Nadel gestrickt (so glühendheiß gar, daß offensichtliche Fehler, wie die Behauptung, das Jahr 1961 liege fünfzig Jahre zurück, keinem Lektor mehr auffielen); als aktuellstes Ereignis fand noch die Razzia vom 12. Juni in Amtsstube und Wohnräumen des Aachener Oberbürgermeisters Jürgen Linden Aufnahme. Gegen den Sozialdemokraten wird wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit dem Bau einer Müllverbrennungsanlage bei Aachen ermittelt. Wie gegen eine ganze Reihe von Kommunalpolitikern und Verwaltungschefs in Nordrhein-Westfalen. Leyendeckers Buch beginnt mit den spektakulären Korruptionsfällen in Wuppertal und endet mit einer minutiösen Rekonstruktion der Geschehnisse um den sogenannten Kölner Müllskandal. Beide Ereignisse wurden im Vorjahr aufgedeckt, und die wichtigsten Gerichtsurteile stehen noch aus. Deshalb haben Leyendeckers Ausführungen den Charakter von Zwischenrufen, und dieses Prinzip bestimmt das Buch.
"Whistleblower" (Signalgeber) nennt man im Englischen jene Bürger, die ohne Rücksicht auf eigene Interessen Hinweise auf Korruption in ihrer Umgebung geben. Nun hat Leyendecker als Journalist zweifellos ein großes persönliches Interesse an der Aufdeckung solcher Fälle. Doch er ist ein vorbildlicher Whistleblower, weil er alles Persönliche aus seinen Erörterungen heraushält. Im Mittelpunkt stehen die Strukturen der Korruption. Das Ausmaß individueller Schuld tritt zurück hinter der Tatsache, daß in Deutschland systematisch bestochen wird.
Diesen Befund dramatisiert Leyendecker nicht - außer in der Einleitung. Dort fehlt etwas die Abgeklärtheit, die ansonsten das ganze Buch auszeichnet. Wenn etwa bereits im zweiten Absatz zur deutschen Situation ausgeführt wird: "Unsere Position in der Weltrangliste der Bananenrepubliken ist mittlerweile ziemlich unerfreulich, Platz achtzehn, zwischen Chile und Belgien; vorne liegt Finnland, hinten Bangladesch", dann ist das eine verwirrende Formulierung. Denn in einer Liste von Bananenrepubliken kann es doch gar keine günstigen Plätze geben; im Gegenteil: Finnland wäre, als Spitzenreiter, die größte Bananenrepublik von allen. Natürlich stellt die Liste aber fest, daß in Finnland besonders wenig Korruption herrscht.
Diese Liste erscheint jährlich, als Ergebnis von Umfragen der Organisation "Transparency International" (TI), der einzigen Vereinigung, die sich ausschließlich dem Kampf gegen Korruption widmet. Einer ihrer Gründer ist der ehemalige deutsche Weltbank-Manager Peter Eigen, und wie es der Zufall will, hat er zur gleichen Zeit wie Leyendecker ein Buch zum gleichen Thema geschrieben: "Das Netz der Korruption". Eigens Ansatz ist in jeder Hinsicht ein anderer. Er beschreibt die Erfolgsgeschichte von TI, und mit der Schilderung der Genese seiner Organisation liefert er zugleich ein Porträt der weltweiten Bestechlichkeit.
Eigen geht es noch weniger als Leyendecker um die Denunzierung von korrupten Menschen, seine Vereinigung will Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption entwickeln, und das in enger Zusammenarbeit mit Institutionen, die korruptionsanfällig sind. Ziel sind sogenannte "Inseln der Transparenz": Vereinbarungen bei der Ausschreibung konkreter Projekte, wo sich alle Beteiligten zusichern, auf Bestechung zu verzichten und im Fall eines Verstoßes die vereinbarten Sanktionen zu akzeptieren. Dabei spielt eine etwaig belastete Vergangenheit der Teilnehmer keine Rolle - so bietet sich die Chance zur Rehabilitation.
Im Gegensatz zu Leyendecker legt Eigen viel Wert darauf, daß diejenigen, die Bestechungsgelder zahlen, nicht weniger korrupt sind als diejenigen, die sie annehmen. Er warnt vor der verbreiteten Annahme, "daß Firmen, die Korruption im Ausland ganz regulär praktizieren, zu Hause nach einer ganz anderen Moral wirtschaften". Für Leyendecker dagegen ist klar: "Der eine will sein Geld vermehren, wenn auch auf anrüchige Weise. Der andere verscherbelt für ein paar Silberlinge seine Integrität, das ist viel schlimmer." Eigens Analyse überzeugt hier mehr, da er moralisch konsequenter argumentiert - und praxisnäher. Dennoch ist sein Buch durch die unvermeidliche Zentrierung auf die eigene Person das schwächere der beiden. Auch weil es mehr im Allgemeinen bleiben muß, denn es verzichtet weitgehend auf Fallgeschichten. Daß Richard von Weizsäcker, der selbst bei TI engagiert ist, Eigens Buch bescheinigt, sich wie ein hochspannender Roman zu lesen, grenzt selbst an Vorteilsgewährung. Wie steht es eigentlich um die Korruption von Vor- und Nachwortschreibern und den von ihnen gefeierten Autoren?
Eines aber stellen beide Bücher deutlich heraus: die Notwendigkeit von Kontrolle. Denn Bestechlichkeit ist kein Vergehen, dessen Folgen offensichtlich sind. Deshalb lobt Leyendecker die deutsche Justiz, "und sehr gelegentlich verschaffen auch die Recherchen von Journalisten ein paar kleine Einblicke". Das ist eine klare captatio benevolentiae, denn das eigene Buch verschafft durchaus tiefe Einblicke. Es möge Pflichtlektüre sein auf den Schreibtischen all jener, die über Privilegien und Aufträge zu entscheiden haben, damit wir niemals sagen müssen: Zustände wie im neuen Deutschland.
ANDREAS PLATTHAUS
Hans Leyendecker: "Die Korruptionsfalle". Wie unser Land im Filz versinkt. Rowohlt Verlag, Reinbek 2003. 287 S., br., 17,90 [Euro].
Peter Eigen: "Das Netz der Korruption". Wie eine weltweite Bewegung gegen Bestechung kämpft. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2003. 302 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
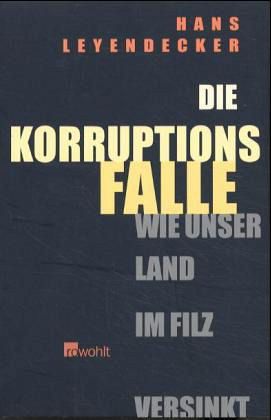





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.2003