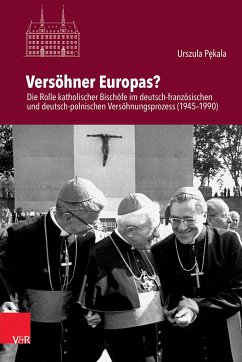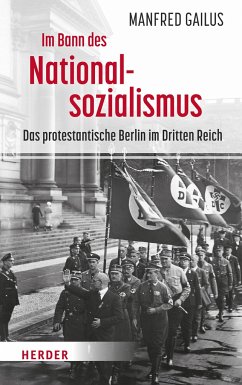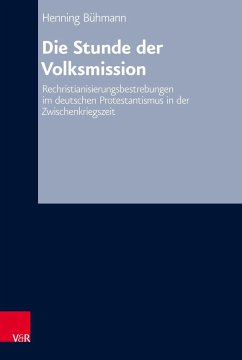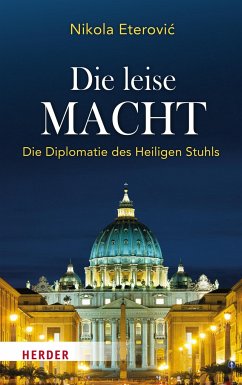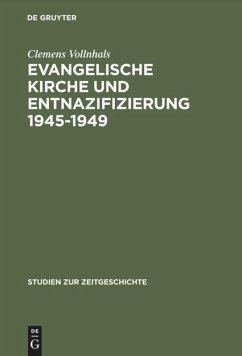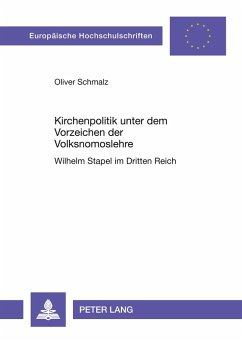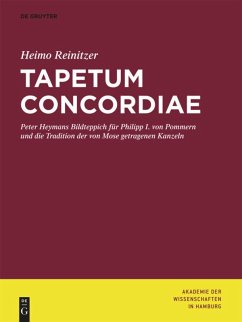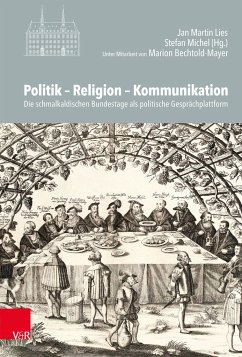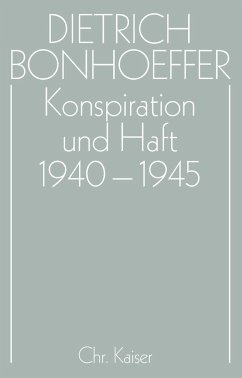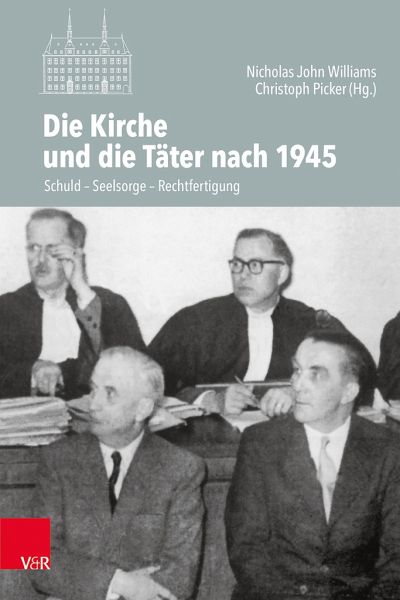
Die Kirche und die Täter nach 1945
Schuld - Seelsorge - Rechtfertigung
Herausgegeben: Williams, Nicholas John; Picker, Christoph;Mitarbeit: Williams, Nicholas John; Picker, Christoph; Gailus, Manfred; von Kellenbach, Katharina; Leiner, Martin; Linck, Stephan; Moisel, Claudia;
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
89,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was führte nach 1945 dazu, dass die evangelische Kirche sich so intensiv um die Täter kümmerte? Welche Rolle wenn überhaupt spielten die Opfer? Es zeichnet sich einerseits ein aus heutiger Sicht verstörendes Bild ab, das andererseits vor dem Hintergrund zeitgenössischer politischer wie theologischer Debatten verstanden werden muss. Damit stellt dieses Buch nicht nur einige Akteure und Netzwerke der kirchlichen Unterstützung von NS-Tätern nach 1945 vor, sondern geht auch auf Erklärungen, Rechtfertigungen und Selbstrechtfertigungen ein. Die Autoren; nehmen dabei auch kritisch Klisch...
Was führte nach 1945 dazu, dass die evangelische Kirche sich so intensiv um die Täter kümmerte? Welche Rolle wenn überhaupt spielten die Opfer? Es zeichnet sich einerseits ein aus heutiger Sicht verstörendes Bild ab, das andererseits vor dem Hintergrund zeitgenössischer politischer wie theologischer Debatten verstanden werden muss. Damit stellt dieses Buch nicht nur einige Akteure und Netzwerke der kirchlichen Unterstützung von NS-Tätern nach 1945 vor, sondern geht auch auf Erklärungen, Rechtfertigungen und Selbstrechtfertigungen ein. Die Autoren; nehmen dabei auch kritisch Klischees zur Wahrnehmung kirchlicher Geschichte in den Blick, wie etwa die Wahrnehmung der Bekennenden Kirche in der Öffentlichkeit. Eine Gesamtschau auf das komplexe Thema rundet das Buch jeweils zu Beginn und Ende ab.