sagt, worauf Jim verwundert fragt: "Warum machen wir's dann?" Und Buzz sagt: "Na, irgendwas muß man ja machen."
Nicholas Ray beschreibt die Welt der nicht mehr jugendlichen, aber eben auch noch nicht erwachsenen Halbstarken, die ihre Unsicherheit und Haltlosigkeit hinter deftigen und mitunter auch feigen Umgangsformen verbergen. Der materielle Wohlstand der fünfziger Jahre steht ihnen dabei als Mittel und gleichzeitig als Objekt ihrer Aggression zu Gebote. Die Autos, die ihnen ihre überforderten Eltern gekauft haben, fahren sie zu Schrott und beweisen auf diese Weise, daß man auch unglücklich sein kann, wenn man keinen Hunger leidet.
"Rebel Without a Cause" heißt im Original Rays Film, und das bringt die Motivationslosigkeit dieses mit verzweifeltem Ernst betriebenen Aufstands treffend zum Ausdruck - irgendwas muß man ja machen. Das dachten auch die Generationen vor James Dean, die ihr Mütchen noch nicht an der Autohaube kühlen konnten, sondern dabei weniger spektakulär zu Werke gehen mußten.
Vier junge Abiturienten in der ungarischen Kleinstadt Kaschau aus zum Teil gutem, zum Teil aber auch weniger gutem Hause rotten sich zusammen, damit ihre Langeweile erträglicher wird. Sie rauchen, trinken und gehen gelegentlich ins Bordell. Aber irgendwann genügt ihnen das nicht mehr. Sie fangen einen absurden Wettbewerb an, bei dem jeder Sachen aus seinem Elternhaus stehlen, verkaufen und den Erlös der Gruppe zur Verfügung stellen muß. Auf den eigentlichen Gewinn kommt es dabei nicht an, was zählt, das ist das Vergehen als solches, auf das sich die Jungen mit der Zeit immer rückhaltloser einlassen - bis die Sache ans Tageslicht kommt und einen der Beteiligten in den Tod treibt.
Der erst vor kurzer Zeit, ein rundes Jahrzehnt nach seinem Selbstmord, in Deutschland entdeckte ungarische Romancier Sándor Márai hat mit seinem nun wiederaufgelegten und von Ernö Zeltner vorzüglich übersetzten Frühwerk "Die jungen Rebellen" von 1929 einen jugendlichen Aufstand mit enormer Einfühlsamkeit beschrieben. Seine eigentliche Zielrichtung bleibt bis zuletzt unklar. Denn daß die Väter dafür verantwortlich sind, was aus ihren Söhnen wird, das steht von Anfang an fest und scheidet als spezifische und tragfähige Motivation für die halbkriminellen Machenschaften des Clans folglich aus. Die Väter sind immer schuld, und irgendeinen Grund, es ihnen heimzuzahlen oder ihnen etwas zu beweisen, wird es schon geben.
Daß Márai sich dieser Kausalität dennoch widmet, hätte sein Sujet zu einem Wagnis werden lassen, verfügte er nicht über die subtile und stellenweise bohrende Psychologie, die schon seinem späteren, aber zuerst wiederentdeckten Roman "Die Glut" Aufmerksamkeit sicherte. Er beläßt die Sache im Ungefähren. Die Perspektive ist unscharf und entspricht der fieberhaften Atmosphäre. Die Väter sind räumlich genauso fern wie der Erste Weltkrieg, an dessen Front sie stehen; sie haben keinen Zugriff mehr auf ihre Söhne, die in einer Gesellschaft, welche dem Untergang entgegengeht und deren Mitglieder aus an Leib und Seele Versehrten bestehen, keinen Platz für sich sehen.
Nur eines ist klar, das als Befund freilich wenig originell ist: Wie die verlogenen Erwachsenen wollen sie nicht werden. Mehr wissen sie aber nicht, wissen anfangs auch nicht und merken es erst, als es bereits zu spät ist, daß sie selbst an einer Verlogenheit scheitern, die tiefer Kränkung und einem entsprechend heftigen Sozialneid entspringt. Ábel, Tibor, Bela und Ernö merken erst am Ende, "daß das Leben in den unvorhersehbaren Augenblicken kaputtgeht, dann, wenn der Mensch etwas verschweigt, feige ist und zuläßt, daß die Ereignisse Gestalt annehmen".
Diese Ereignisse sind keineswegs spektakulär; der Ärger mit dem Pfandleiher Havas, den auch Dostojewskij hätte erfinden können, ist eigentlich schon alles. Die Handlung, die sich über anderthalb schwüle Maitage erstreckt, wird interessant in den Nuancen. Ein schweigsames Milieu ist das, in dem sich die Jungen gegen das Erwachsensein stemmen, bevölkert mit Kriegsversehrten, Trinkern und Prostituierten; angereichert mit latent homosexuellen Verstrickungen, die das ohnehin heikle Sündenbewußtsein der Jungen noch verschärfen; eine Welt der Dekadenz und gleichzeitig der Armut ist das schließlich, in der nicht leicht auszumachen ist, wer besser dran ist: der einsame, vollständig sich selbst überlassene Sohn eines angesehenen Obersten oder der immer wieder gedemütigte Sohn eines armen Schusters. Es ist eine Väter-und-Söhne-Geschichte, die an Turgenjew denken läßt. Aber Márais Geschichte ist Turgenjews Werk überlegen; er ist nicht so holzschnittartig und kommt ohne großsprecherische Ideologie aus.
Sándor Márai, der als Spezialist für Abgesänge bereits einschlägig bekannt ist, hat vor mehr als siebzig Jahren einen tiefgründigen, stilistisch noblen Roman geschrieben, für dessen Wiederentdeckung es jetzt Zeit ist.
Sándor Márai: "Die jungen Rebellen". Roman. Aus dem Ungarischen übersetzt von Ernö Zeltner. Piper Verlag, München und Zürich 2001. 278 S., geb., 26,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




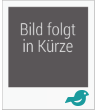

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2001