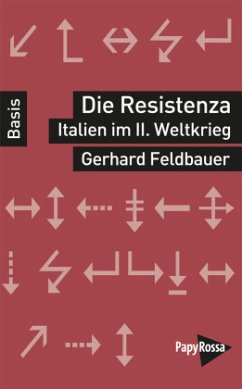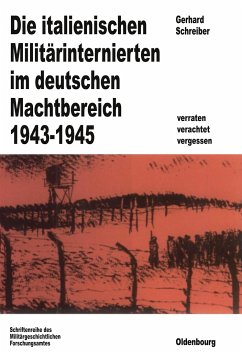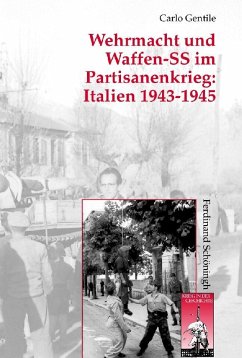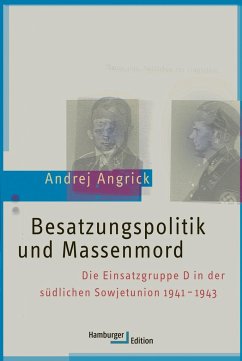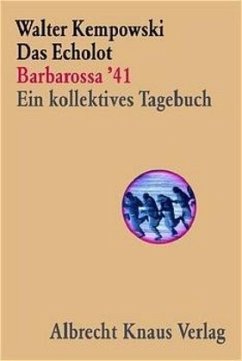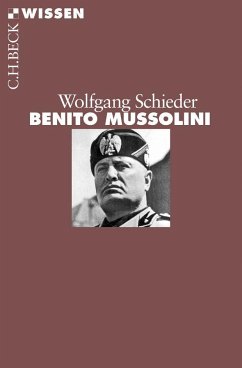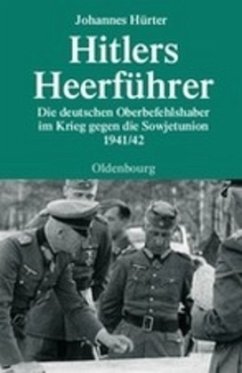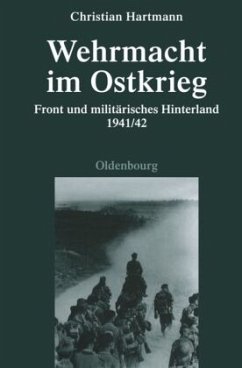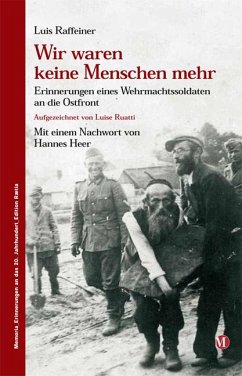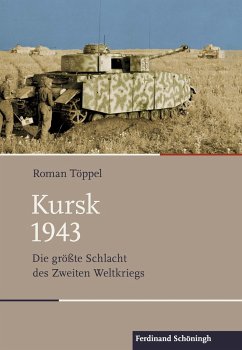der späten Annäherung Mussolinis an Hitler 1936/37 aber auch in umgekehrter Richtung. Darüber erfährt man in dem Sammelband manches Neue.
Daniela Liebscher und Petra Terhoeven können in ihren Aufsätzen über die faschistische "Opera Nazionale Dopolavoro" als Modell für "Kraft durch Freude" und über Spendenkampagnen auf eigene Monographien zurückgreifen. Frau Liebscher analysiert unter anderem die sozialpolitische "Achse" der Jahre 1937 bis 1940, welche die Freizeitgestaltung in die Leistungskraft der Nation einordnete. Waltraud Sennebogen vergleicht Werbestrategien und Werbepraxis, führt damit über die bloß nationale Perspektive der älteren Propagandaforschung hinaus und analysiert auch die damals neuartigen Zusammenhänge zwischen Propaganda und Werbung. Aber signifikante Differenzen ergaben sich aus dem positiveren Verhältnis des Faschismus zur modernen Kunst.
Amedeo Osti Guerrazzi und Costantino Di Sante insistieren auf dem Repressivcharakter des Faschismus und berichten von den zirka fünfzig meist kleinen "Konzentrationslagern" in Italien, die aber erst im Krieg eingerichtet worden sind, vor allem zur Internierung ausländischer Flüchtlinge, mehrheitlich Juden. Gemäß einem neueren Topos wird das größte dieser Lager, Ferramonti in Kalabrien, als "berüchtigt" bezeichnet, dann aber zugegeben, daß die Behandlung im allgemeinen menschlich war, vom Roten Kreuz kontrolliert und vom Vatikan verbessert werden konnte. Ein Umschlag ins Totalitäre ist erst unter dem bestimmenden Einfluß der Deutschen ab 1943 in der Repubblica Sociale erfolgt.
Thomas Schlemmer beschreibt die von Mussolini wohl mehr aus politischen als aus den hier herausgestellten ideologischen Gründen gewollte Teilnahme einer italienischen Armee am Rußland-Krieg, die mit deren Zerschlagung durch die Rote Armee (Dezember 1942/Januar 1943) katastrophal geendet hat. Die italienische Besatzungspolitik wird in die Nähe der deutschen gerückt, aber die Problematik des Partisanenkriegs, welcher die harten Repressalien provozierte, zuwenig erörtert. Eine erweiterte Fassung dieses Beitrags hat Schlemmer separat unter dem Titel "Die Italiener an der Ostfront 1942/43" publiziert - angereichert mit fünfzehn deutschen und vierzehn italienischen Dokumenten.
Die Herausgeber des Faschismus-Bandes geben sich mit dem Nachweis partieller oder später Gemeinsamkeiten nicht zufrieden. Sie behaupten, daß erst die jüngere Forschung den Faschismus als Prozeß und als sowohl politikgeschichtliches wie kulturgeschichtliches Phänomen analysiert und die rassistische Gemeinsamkeit der Regime in Italien und Deutschland erwiesen hätte. Dabei findet keine Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen von Renzo De Felice, Karl Dietrich Bracher, Andreas Hillgruber und Klaus Hildebrand statt. Erwähnt wird weder De Felices grundlegendes Werk über die Geschichte der Juden unter dem Faschismus (1961) noch ein Buch von Ester Capuzzo (2004), das ähnlich wie De Felice in der Zuwendung vieler Juden zum Zionismus und nicht im Rassismus einen Hauptgrund für Mussolinis Bruch mit ihnen sieht. Daß der "Duce" fünfzehn Jahre lang die Juden eher förderte, 1930/31 die Rechtsstellung ihrer Gemeinden erheblich verbesserte und sie während des Krieges in den von Italien besetzten Gebieten schützen ließ, wird einfach unterschlagen. Statt dessen wird aus italienischen Kriegsverbrechen in Afrika und auf dem Balkan auf durchgängigen Rassismus geschlossen, doch müssen die Herausgeber Reichardt und Nolzen immerhin zugeben, daß die Initiative zum Holocaust nur vom nationalsozialistischen Deutschland ausgegangen ist.
Der 1996 verstorbene De Felice ersetzte die Verurteilung des Faschismus durch eine differenzierende und jene Unterschiede zum Nationalsozialismus betonende historische Analyse; über Jahrzehnte hinweg sollten ihn wissenschaftliche Kontrahenten des linken Spektrums dafür des "Revisionismus" beschuldigen. Eine gewisse Tendenz, das OEuvre De Felices abzuwerten, spricht auch aus dem an sich höchst lesenswerten Aufsatz von Wolfgang Schieder über Giuseppe Renzetti (1891 bis 1953). Dieser war von 1924 bis 1941 der effizienteste Propagandist des Faschismus in Deutschland und seit den späten zwanziger Jahren der wichtigste Vermittler zwischen der deutschen Rechten - dann speziell der NSDAP - und den Faschisten, auch direkt zwischen Hermann Göring, Hitler und Mussolini.
Renzettis Wirken wird umfassend nachgezeichnet - auch auf Grund von neu erschlossenen Quellen. Schieder teilt zwar mit, daß schon De Felice Berichte Renzettis veröffentlicht habe, aber er verschweigt, daß der italienische Historiker die Berliner Aktionen Renzettis für die entscheidenden Jahre 1930 bis 1933 detailliert darstellte - und zwar sowohl in einem speziellen Buch über die geheimen Beziehungen Mussolinis und Hitlers als auch in der großen Mussolini-Biographie. Zu erinnern ist zudem daran, daß gerade De Felice eine Edition der Hitler-Mussolini-Korrespondenz samt den Berichten Renzettis anregte und deren Anfänge sehr förderte. Daß diese Edition bis heute nicht vorliegt, steht auf einem anderen Blatt.
Damnatio memoriae? Da hat Italiens Linke mehr hinzugelernt, denn Roms postkommunistischer Oberbürgermeister Veltroni läßt soeben eine Straße nach De Felice benennen - und abgesehen von alt gewordenen Dogmatikern stimmen dieser Ehrung sogar die früheren Gegner zu.
RUDOLF LILL
Sven Reichardt/Armin Nolzen (Herausgeber): Faschismus in Italien und Deutschland. Studien zu Transfer und Vergleich. Wallstein Verlag, Göttingen 2005. 283 S., 20,- [Euro].
Thomas Schlemmer (Herausgeber): Die Italiener an der Ostfront 1942/43. Dokumente zu Mussolinis Krieg gegen die Sowjetunion. Oldenbourg Verlag, München 2005. 291 S., 34,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2006