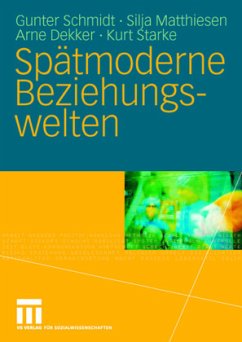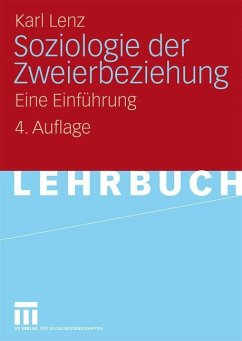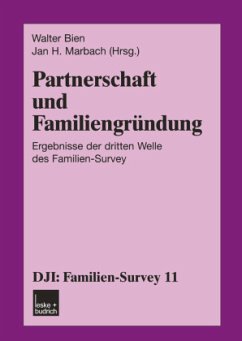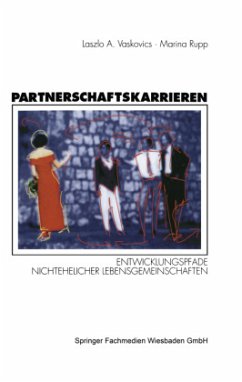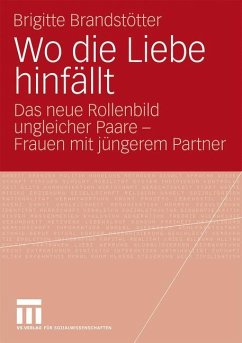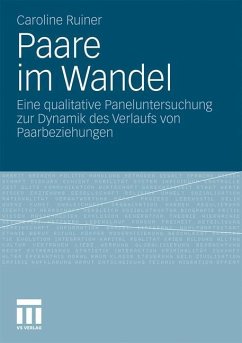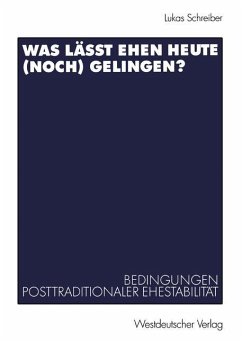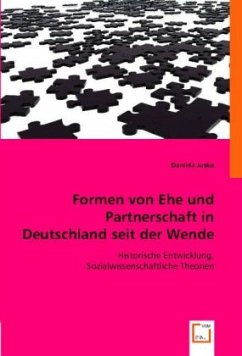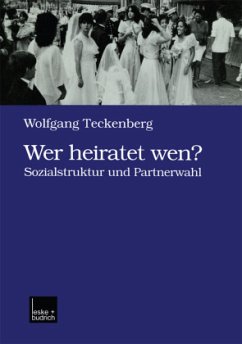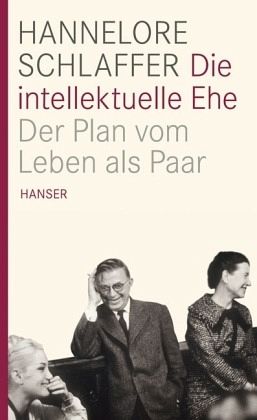
Die intellektuelle Ehe
Der Plan vom Leben als Paar
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
18,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Getrennt wohnen oder zusammen, mit oder ohne Kinder, gegenseitige Treue oder offene Beziehung - dass Paare heute über all dies gleichberechtigt verhandeln können, hat eine heroische Vorgeschichte. Eine Avantgarde von Lebensreformern aus Soziologie, Psychologie und der Kunst stellte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die traditionelle Ehe in Frage und entwarf eine neue Form des Lebens als Paar. Hannelore Schlaffer verfolgt die Debatten - von der Schwabinger Bohème bis zu dem illustren Verhältnis zwischen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. In ihrer Schilderung geglückter und misslungener ...
Getrennt wohnen oder zusammen, mit oder ohne Kinder, gegenseitige Treue oder offene Beziehung - dass Paare heute über all dies gleichberechtigt verhandeln können, hat eine heroische Vorgeschichte. Eine Avantgarde von Lebensreformern aus Soziologie, Psychologie und der Kunst stellte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die traditionelle Ehe in Frage und entwarf eine neue Form des Lebens als Paar. Hannelore Schlaffer verfolgt die Debatten - von der Schwabinger Bohème bis zu dem illustren Verhältnis zwischen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. In ihrer Schilderung geglückter und misslungener Versuche ist ein Entwurf der modernen Ehe entstanden, der Denkstoff für alle ist, die sich auf ein Leben als Paar einlassen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.