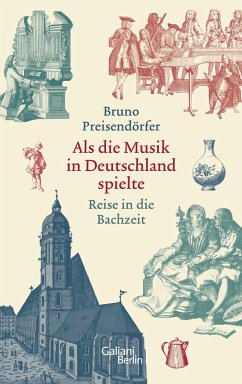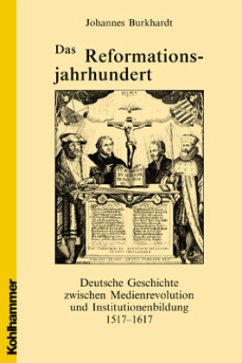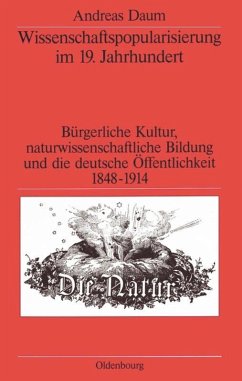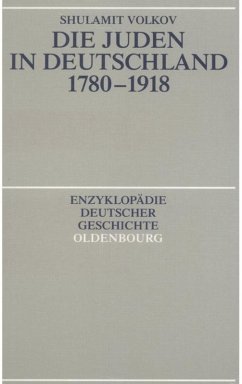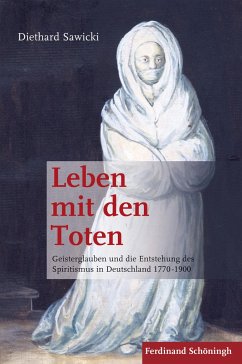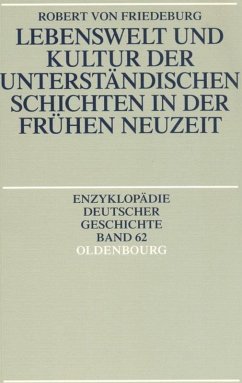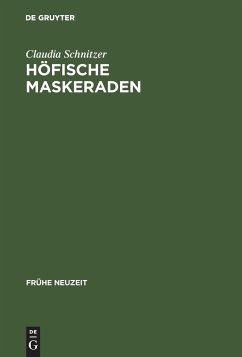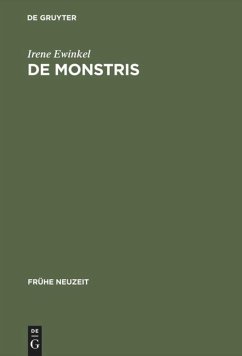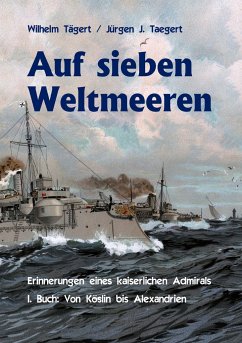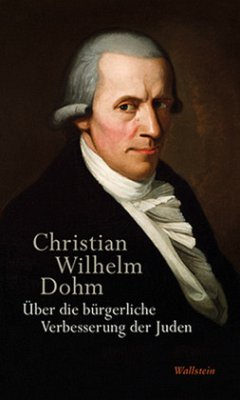Die Göttinger Sieben
Kritik einer Legende
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die sieben Göttinger Professoren unter ihnen die Brüder Grimm die 1837 gegen die Aufhebung der hannoverschen Verfassung protestierten und daraufhin entlassen wurden, gelten als Märtyrer der Überzeugungstreue und als Vorkämpfer demokratischer Bürgerrechte, König Ernst August, der sie entließ, dagegen als finsterer, despotischer Rechtsbrecher. Die Arbeit will zeigen, daß dieses Schwarzweißbild zum guten Teil das Ergebnis einer nicht zuletzt von den Betroffenen selbst geschaffenen Legende ist einer Legende, die gerade in ihrer unpolitischen Version so populär wurde, weil die Höhersch�...
Die sieben Göttinger Professoren unter ihnen die Brüder Grimm die 1837 gegen die Aufhebung der hannoverschen Verfassung protestierten und daraufhin entlassen wurden, gelten als Märtyrer der Überzeugungstreue und als Vorkämpfer demokratischer Bürgerrechte, König Ernst August, der sie entließ, dagegen als finsterer, despotischer Rechtsbrecher. Die Arbeit will zeigen, daß dieses Schwarzweißbild zum guten Teil das Ergebnis einer nicht zuletzt von den Betroffenen selbst geschaffenen Legende ist einer Legende, die gerade in ihrer unpolitischen Version so populär wurde, weil die Höherschätzung von Gesinnung und Überzeugung gegenüber politisch-juristischer Urteilsfähigkeit gerade in Deutschland eine lange und nicht nur erfreuliche Tradition hat. Ein spezielles Thema der Arbeit ist in diesem Zusammenhang das Erscheinungsbild des politischen Professors und die Rolle Jacob Grimms in der Politik.