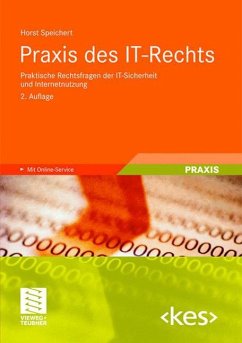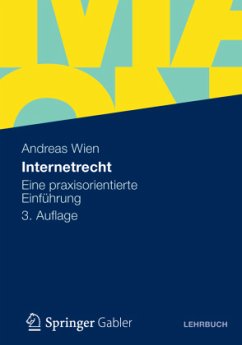Nicht lieferbar
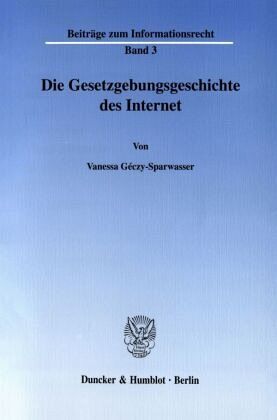
Die Gesetzgebungsgeschichte des Internet.
Die Reaktion des Gesetzgebers auf das Internet unter Berücksichtigung der Entwicklung in den U.S.A. und unter Einbeziehung gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben.. Dissertationsschrift
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Wie reagiert das Recht auf Technik, wie reagiert der Gesetzgeber auf Technik? Dieser Frage geht der Autor der vorliegenden Arbeit am Beispielsfall des Internet nach.Nachdem als theoretischer Hintergrund gängige Annahmen der Rechtswissenschaft zu dem Verhältnis von Recht und Technik dargestellt werden, beginnt der Verfasser mit der Schilderung der »tatsächlichen Geschichte des Internet«, seiner Entwicklung von einem staatlichen Forschungsnetzwerk und »Zufallsprodukt« hin zu dem weltumspannenden World Wide Web, dem Rückgrat der Informationsgesellschaft.Vor diesem Hintergrund werden zunä...
Wie reagiert das Recht auf Technik, wie reagiert der Gesetzgeber auf Technik? Dieser Frage geht der Autor der vorliegenden Arbeit am Beispielsfall des Internet nach.
Nachdem als theoretischer Hintergrund gängige Annahmen der Rechtswissenschaft zu dem Verhältnis von Recht und Technik dargestellt werden, beginnt der Verfasser mit der Schilderung der »tatsächlichen Geschichte des Internet«, seiner Entwicklung von einem staatlichen Forschungsnetzwerk und »Zufallsprodukt« hin zu dem weltumspannenden World Wide Web, dem Rückgrat der Informationsgesellschaft.
Vor diesem Hintergrund werden zunächst die Reaktionen zweier potentiell zentraler Akteure bei dem Aufbau des Informationsrechts beleuchtet: die der Europäischen Union und die der Vereinigten Staaten. Erst im Anschluß daran erfolgt die genaue Rekonstruktion der Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf das Internet von der ersten Erwähnung im Bundestag bis zu konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen wie dem IuKDG. Dabei stellt sich heraus, daß der deutsche Gesetzgeber sehr autonom und innovationsfreudig die Herausforderungen der Informationsgesellschaft annehmen wollte.
Der Autor zeigt, daß sich viele Thesen zu dem Verhältnis von Recht und Technik zumindest an dieser zentralen Entwicklung nicht bestätigen lassen.
Nachdem als theoretischer Hintergrund gängige Annahmen der Rechtswissenschaft zu dem Verhältnis von Recht und Technik dargestellt werden, beginnt der Verfasser mit der Schilderung der »tatsächlichen Geschichte des Internet«, seiner Entwicklung von einem staatlichen Forschungsnetzwerk und »Zufallsprodukt« hin zu dem weltumspannenden World Wide Web, dem Rückgrat der Informationsgesellschaft.
Vor diesem Hintergrund werden zunächst die Reaktionen zweier potentiell zentraler Akteure bei dem Aufbau des Informationsrechts beleuchtet: die der Europäischen Union und die der Vereinigten Staaten. Erst im Anschluß daran erfolgt die genaue Rekonstruktion der Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf das Internet von der ersten Erwähnung im Bundestag bis zu konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen wie dem IuKDG. Dabei stellt sich heraus, daß der deutsche Gesetzgeber sehr autonom und innovationsfreudig die Herausforderungen der Informationsgesellschaft annehmen wollte.
Der Autor zeigt, daß sich viele Thesen zu dem Verhältnis von Recht und Technik zumindest an dieser zentralen Entwicklung nicht bestätigen lassen.