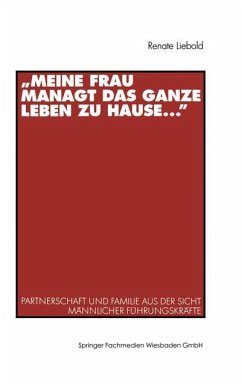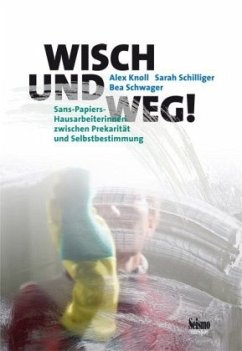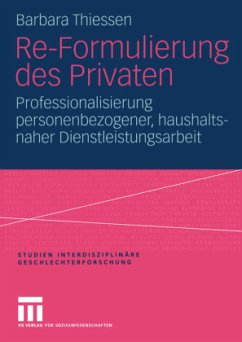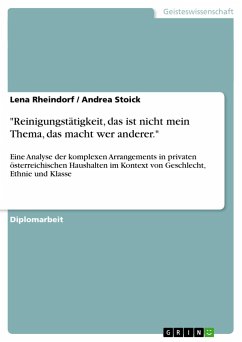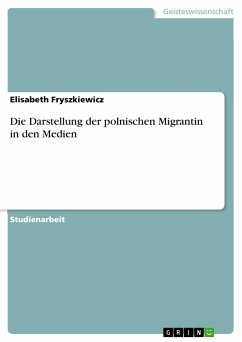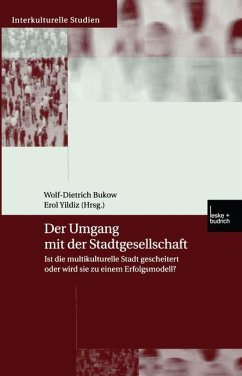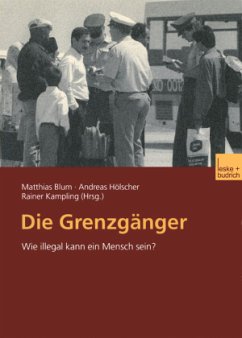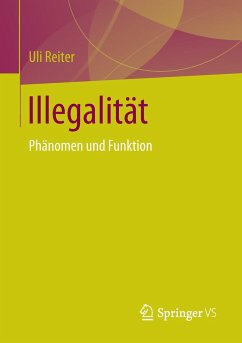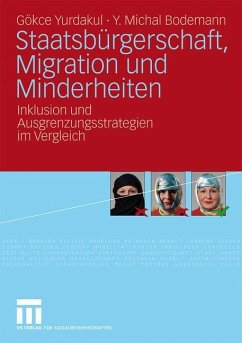Ungefähr ein Jahr lang hielten wir es mit den fast täglichen Streitereien über eine gerechte Verteilung der Haushaltsaufgaben aus, dann taten wir das bis dahin Undenkbare und engagierten eine Putzfrau - aus Polen.
Gunio kriegte nicht viel mit von Olga, deren Schwester schon seit einiger Zeit das Haus unserer Freunde versorgte, denn anders als ich arbeitete er mittlerweile in einem Büro. Wenn er nachmittags nach Hause kam, war äußerlich alles in bester Ordnung. Vor dem vereinbarten Putztermin hatte ich zwei Stunden die Wohnung aufgeräumt und das Geschirr gewaschen, mit dem kleinen Langenscheidt in der Hand versucht, Olga über unsere Sprachbarriere hinweg einen herzlichen Empfang zu bereiten, und in der Hoffnung, die dringlichsten Aufgaben würden ihr ins Auge fallen, die Flucht ergriffen.
Mit einem schlechten Gewissen - weil wir nicht miteinander warm geworden waren, weil ich drei Stunden spazieren-, einkaufen, Kaffee trinken ging, statt zu arbeiten, weil ich nicht selbst putzte. Die Gerechtigkeitsdebatte führten wir am Abend unter veränderten Vorzeichen fort: Sie zerfiel in einen weltpolitischen Teil, dessen Tragweite unsere moralischen Intuitionen ins Leere laufen ließ, und einen beziehungskritischen Teil, der sich darauf konzentrierte, mein Selbstbewußtsein als Arbeitgeberin zu stärken. Im Prinzip verständigten wir uns darauf, am Vorabend des Putztags gemeinsam aufzuräumen.
Für solche Diskussionen ist mit Haus und Kindern heute keine Zeit mehr. Ohne Babysitter (aus Sri Lanka und Puerto Rico) und Putzhilfe (aus Ex-Jugoslawien) wäre der Alltag nicht zu bewältigen. Gelesen wird nur noch, was praktischen Nutzen verspricht, wie etwa das am Hamburger Institut für Sozialforschung entstandene Buch "Die ganze Welt zu Hause".
Die Soziologin Maria Rerrich macht darin auf die Heerschar von Frauen aufmerksam, die meist illegal nach Deutschland kommt, um unsere Wohnungen zu putzen, unsere Kinder zu hüten und unsere Alten zu pflegen. Anders als den hilflosen Disputen, in denen wir früher den Zusammenhang zwischen globaler und häuslicher Gerechtigkeit zerfaserten, gelingt es Rerrichs Dokumentation, das Wohlstandsgefälle in der Welt und das Machtgefälle im Haus in einem paradoxen Bild der Weiblichkeit aufzufangen: dem der "cosmobilen Putzfrau".
Was ist die "cosmobile Putzfrau"? Sie stellt wie jedes andere Frauenbild eine Norm dar, zu der sich wirkliche Frauen in ein Verhältnis setzen können. Glaubt man den von Rerrich skizzierten Zusammenhängen, dann schrumpft mit fortschreitender Globalisierung die Freiheit, dies nicht zu tun. Urbild jener dynamisierten archaischen Figur ist die Mutter, die, weil ihr Mann arbeitslos ist, Heimat und Familie verläßt, um in der Fremde putzen zu gehen. Sie schickt einen Großteil ihres Verdienstes an die Familie zurück, die sie als illegale Migrantin oft über Jahre nicht sieht. Arbeitet sie nur ohne Genehmigung im Ausland, dann kann sie pendeln und wenigstens sporadisch in ihrem eigenen Haushalt nach dem Rechten sehen, das heißt unentgeltlich kochen und putzen, familiäre Krisen ausbügeln, ihre zukünftige Abwesenheit mit Hilfe anderer - verwandter oder wiederum angestellter - Frauen organisieren.
Angesichts der von Rerrich diagnostizierten Alltagsvergessenheit der Männer scheint es keine so große Rolle zu spielen, welche Stelle eine Frau in der "global care chain" einnimmt, jener "Kette größerer und kleinerer Kooperationsbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen Frauen", die im Dienst der Fürsorge "manchmal den halben Globus" umspannt: Die in Deutschland putzende Polin läßt ihren Haushalt vielleicht von einer Ukrainerin besorgen, deren Lücke eine Weißrussin füllt, die Kinder der emigrierten Mexikanerin befinden sich in der Obhut von deren Mutter, Schwester, Cousine.
Mit ihrem als "Sehhilfe" gedachten schmalen Bändchen schreibt Rerrich ein Thema fort, das die amerikanische Soziologie recht gut erforscht hat. 1998 legte Rhacel Parreñas, die Tochter einer Arbeitsmigrantin aus den Philippinen, eine vergleichende Studie der Lebensbedingungen philippinischer Haushaltsarbeiterinnen in Italien und den Vereinigten Staaten vor. Parreñas' einflußreiche Darstellung der in keiner Gesellschaft mehr integrierten "Dienerinnen der Globalisierung" und ihrer "transnationalen Familien" macht deutlich, daß sich die Arbeitgeberinnen in den Industrienationen nicht umstandslos mit den "Gastarbeiterinnen" auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen: Die feministische Idee von der globalen Fürsorglichkeitskette ist zwar suggestiv, aber am Ende nicht schlüssig.
Denn während zur Zeit mehrere Millionen philippinischer Frauen in häuslichen Diensten weltweit unterwegs sind, wächst Rerrich zufolge fast ein Drittel aller philippinischen Kinder zumindest zeitweise ohne Mutter oder Vater auf. Zu den Schäden, die der Exodus weiblicher Arbeitskräfte verursacht, rechnet sie aber ebenso das, was sich aus Sicht der Herkunftsländer als Verlust, global gesehen als Verschwendung von Intelligenz und Fachwissen darstellt. Oft sind es die gebildeteren Frauen, die lieber im Ausland gut verdienen als in Ausübung eines angesehenen Berufes daheim in Armut leben wollen. Die Herkunftsländer scheinen aber den migrationsbedingten "brain drain" gerne in Kauf zu nehmen, wenn die Putzfrauengehälter wieder die eigenen Ökonomien bereichern. So erleichtert etwa die philippinische Regierung nicht nur den Rückfluß von Devisen, sondern wirbt offenbar auch indirekt für den illegalen Arbeitsplatz in Übersee.
Wenn vielleicht das Band der Fürsorge nicht ganz um den Globus reicht, läuft doch das Geschäft mit der Arbeit über alle Kontinente wie geschmiert. Der deutsche Staat, so Rerrichs Diagnose, ist keinen Deut weniger auf die heimlichen Dienste ausländischer Sorge- und Pflegekräfte angewiesen als die Staaten, aus denen diese anreisen. Was anderes als ein Rechenfehler könnte also die ehemalige Bundesregierung dazu bewogen haben, das "dirty little secret" des deutschen Wohlfahrtsstaates lüften zu wollen? Beim ersten Anzeichen von Widerstand aber kalkulierte sie neu und besann sich, schnell wieder den Teppich des Schweigens über die unsaubere Gemengelage aus häuslicher Versorgungslücke, bezahlbarer Schwarzarbeit und Xenophobie zu breiten.
Rerrich, die hier die Ergebnisse einer internationalen Diskussion auf bundesdeutsche Verhältnisse appliziert, zimmert gegen den gewaltigen Druck der globalisierten Wirtschaft nun an einem innenpolitischen Damm. Ihr Plädoyer, die "Sorge für die notwendigen Belange des täglichen Lebens" wieder zur gesellschaftlichen Aufgabe zu befördern, beinhaltet zweierlei: Angesichts der demographischen Entwicklung sollte ihres Erachtens auch der Staat ein Interesse daran haben, daß sich Männer und Frauen die Arbeit im Haushalt gerechter aufteilen. Mit dem Ziel, die "patriarchalen Webfehler" in der Struktur unseres Wohlfahrtsstaates - wie etwa Ehegattensplitting oder Halbtagsschule - zu korrigieren, ruft sie deshalb einerseits zu einer "Repolitisierung des Privaten" auf.
Bei der Hausarbeit, die nicht aus "Liebe", sondern gegen Geld verrichtet wird, fällt dann allerdings stärker ins Auge, daß der Politisierung zum anderen auch eine Verrechtlichung des Privaten folgen muß. Wer Schwarzarbeit im Haushalt - und sei es aus Solidarität mit den Migrantinnen - nicht möchte, muß sie verbieten. Die anschließende "Kriminalisierung der Betroffenen", gegen die sich Rerrich verwahrt, gehört zum Vater Rechtsstaat wie das Amen in die Kirche. Putzen für die Reichen und beten für die Armen bleibt Frauensache, die um so mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden wird, je freizügiger man sie sich vorstellt.
BETTINA ENGELS
Maria S. Rerrich: "Die ganze Welt zu Hause". Cosmobile Putzfrauen in privaten Haushalten. Hamburger Edition, Hamburg 2006. 168 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
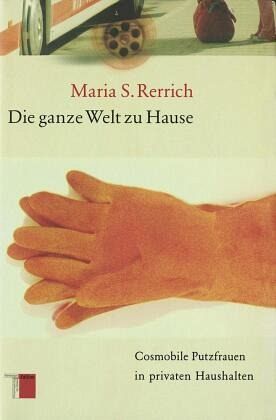




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2006