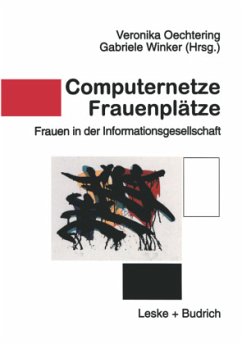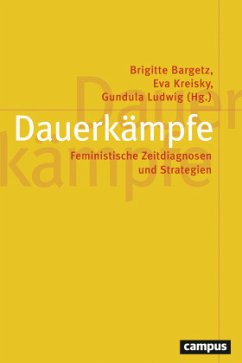"klassisch weibliche Lebensprogramm" wählen. Sie arbeiten gar nicht mehr oder nur wenig und versorgen die Kinder. Um die Ursachen zu ergründen, will die Autorin "signifikante weibliche Verhaltensweisen" aufzeigen. Sie will nicht weniger als eine Analyse der weiblichen Verfasstheit hierzulande, was eine Anmaßung und ein großes Vorhaben ist, bei dem es naturgemäß Verletzte gibt, weil es eben sehr persönlich wird.
Die Frauen, so Mikas Schlagzeilen-These, "wollen es gar nicht anders", was ein wenig an das in Filmszenen von peinlichen Männern geäußerte "Baby, du willst es doch nicht anders" erinnert. Aber gut, die Frauen wollen es also nicht anders und fürchten sich vor dem Arbeitsleben, das vor der Haustür wartet, weshalb sie lieber drinnen bleiben und die Kinder verwalten. Die Frauen, so Mika, wollen nicht auf die Privilegien verzichten, die ihnen die Unterordnung in einem eheversorgten Leben garantiert. Die Frauen werden dann später vielleicht von ihrem Mann verlassen, die Kinder gehen auch, dann stehen sie alleine da und verarmen.
Dieses Frauenschicksal wird meist durch Liebe verursacht. Die Frauenköpfe sind nämlich mit Liebesfilmen und Liebesromanen vollgestopft, woran ja schon Emma Bovary gestorben ist. Die Frauenköpfe sind also liebes- und heiratsbesessen und außerdem gefallsüchtig. Die Frauen sind aus Angst vor dem drohenden Mannverlust reihenweise bereit, ihre Eigenständigkeit wegzuwerfen, anstatt gegen ungerechte Aufgabenverteilung aufzubegehren; und wenn sie es tun, dann oft auf die passiv-aggressive Weise. Die Frauen wollen in unserer komplizierten globalisierten Welt einen Mann, der für sie denkt und sie vervollständigt. Die Wurzel des ganzen Übels ist die Rolle, welche ihnen schon von Kindesbeinen "antrainiert" wird. Durch die Familien, durch "Germany's Next Topmodel" und durch die Farbe Rosa werden die Mädchen nicht zu krawalligen Pippi Langstrumpfs, sondern zu braven Annikas erzogen. Dabei, so die Autorin, sollte man ihnen, wie den Jungs, beibringen, aggressiver und durchsetzungsfähiger zu werden. Aber weil das niemand macht, "stolpern" sie in die Rollenfalle, bereits infiziert vom Mutterwunsch, der Mutterrolle, die dringend entmystifiziert gehöre, insbesondere in Deutschland. Man kann nämlich auch ohne Kinder ein erfülltes Leben haben.
Zusammengefasst liest sich das ein bisschen wie ein schlechter Thomas Bernhard, und doch sind Mikas Befunde das Nachdenken wert - was der Leserin allerdings an vielen Stellen des Buches unmöglich gemacht wird. Es ist dabei weniger das Problem, was Bascha Mika schreibt, sondern wie sie schreibt und aus welcher Position heraus. Sie als erfolgreiche, kinderlose Vorzeigefrau sagt all jenen Frauen, die es ihrer Meinung nach nicht auf die Reihe gekriegt haben, was sie falsch gemacht haben und worauf sie in Zukunft achten sollten. Das Ganze illustriert von Richtig-und-Falsch-Beispielen, von Frauenbeispielen, von Bettinas und Hildes und Adas, die es entweder total versaut oder ganz toll hingekriegt haben.
Das Buch ist ein erhobener Zeigefinger - ein brutaler, der in Frauenbiographien herumstochert. Das Unangenehme dabei ist, dass der Zeigefinger einer Frau gehört, die ihren eigenen Maßstäben nach ja all das hat, was sie den Frauen, ihren Adressatinnen, beizubringen versucht: Karriere, finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Aus dieser luxuriösen Position heraus ist es leicht, über die kalte Welt zu schreiben, in die sich die anderen nicht hineintrauen, und vor diesem Hintergrund ist es unpassend, wenn sie von "uns Frauen" schreibt. Denn ihre Frauen-Anklage-Schrift schließt sie selbst implizit aus, gibt jedoch etwas anderes vor. Ungeschickt ist die "Wir-Frauen-Rhetorik" außerdem, weil sie einem Lagerdenken angehört, das für junge Frauen, die sie zur Eigenständigkeit erziehen will, völlig unverständlich ist.
Verstörend wirken auch die Kampf-Vokabeln, oft der Militärsprache entlehnt, die Parolen und Schlachtrufe und die vielen Vergleiche aus dem Tierreich. Frauen "hühnern" herum und "vermausen", manche von ihnen verhalten sich gar "parasitär", sie "landen in der Grube" und im "Kerker", "Fallen" schnappen zu, Liebe "grassiert"; von "Gegnern" und "Geiseln" ist die Rede, von "kämpfen" und "gewinnen", von "Aggression" und "Biss"; und schließlich werden Frauen als feige "Weichlinge" bezeichnet, die in die "Komfortzone desertieren", obwohl sie sich besser ein Beispiel an bestimmten Vögeln, nämlich den Raben, nehmen sollten.
So ein Frauenleben ist ziemlich gefährlich, denkt man, wenn man dieses Buch liest, dessen Lektüre ebenfalls gefährlich, weil stellenweise schlicht beleidigend ist. Es enthält so viele indirekte Handlungsanweisungen und Vorwürfe, dass es für eine selbständig denkende Frau, die man ja sein oder werden soll, unerträglich ist, das zu lesen. Das Buch bringt die Leserin in eine dumme, ja unwürdige Position: in die der Belehrten, Bevormundeten. Das Gegenteil soll sie jedoch sein, und insofern trägt dieses Leser-Autor-Verhältnis in sich eine unfreiwillige Ironie. Denn in Bascha Mikas Buch "taumeln", "stolpern" und "verrennen sich" Frauen dauernd, weshalb es wohl dringend Zeit wurde, dass mal jemand kommt, der ihnen zeigt, wo es langgeht, was ja normalerweise die Männer aus den Filmszenen übernehmen.
Am besten, denkt man und legt kopfschüttelnd das Buch zur Seite, hört man einfach auf, eine Frau zu sein. Natürlich ist Mika viel zu links und aufgeklärt, um das zu verlangen; an einer Stelle spricht sie sich explizit dagegen aus. Dennoch wird man den Eindruck nicht los, dass da eigentlich etwas ganz anderes steht, wenn man die wiederholten Aufrufe zum Aggressivsein und Kämpfen liest. Wenn von "Mädchengetue" und einer Gesellschaft die Rede ist, die "von uns Weiblichkeit fordert", wenn die achtundzwanzigjährige Ada zu Wort kommt, die zugibt, dass auch sie "diese Mädchenseiten" an sich kenne, oder die Naturwissenschaftlerin Christiane Nüsslein-Volhard zitiert wird, welche zu überschminkten Pubertätsmädchen sagt, sie sollten aufs Klo gehen, um sich abzuwaschen, weil sie mit "so was" nicht rede. Wenn "so was", also die gleichgeschalteten und überangepassten Pubertätsmädchen, dann, ihrem Erziehungsprogramm gemäß, in die Ehe getaumelt sind, ist fast alles verloren. Dann werden sie, der gesellschaftlichen Erwartung entsprechend, vom Mutterschaftsgedanken besessen. Sie werden also Mütter, und als Mutter erliegt man, mehr noch denn als Frau, dem "Kümmersyndrom", einer speziellen Frauenkrankheit, wie Mika weiß, die verhindert, dass die Befallene sich mit prestigebringender Arbeit beschäftigt. Sie ist dann nur noch Mutter - ein Befund, der nicht nur pauschal und abschätzig ist, sondern in seiner Grundannahme auch menschenfern.
Mutter zu sein ist ja nicht nur Rolle, Ideal oder Meta-Dings, sondern vermutlich auch ein sehr starker Wunsch. In Mikas Lebensverständnis aber hat man immer die Wahl: Man kann sein Leben ganz und gar dem Machbarkeitswillen unterordnen, was eine größenwahnsinnige Menschenidee ist, die vom Alltagsleben ja immer wieder korrigiert wird. Lebensfern und aus selbstverwirklichter Journalistensicht geschrieben ist zudem das Loblied auf die Arbeit, welches Bascha Mika anstimmt. Nicht jeder Beruf ist erfüllend und sinnstiftend, es gibt die entsetzlichsten, die stupidesten Beschäftigungsverhältnisse, vor denen zu flüchten absolut nachvollziehbar ist. Eine Kritik der "umfassenden Ökonomisierung unserer Lebenswelt", die bei einem solchen Rundumschlag nicht fehlen sollte, findet aber nur sehr verhalten statt. An manchen Stellen ist die Sprache der Streitschrift eher ein Zeugnis totaler Ökonomisiertheit. So sind Kinder nur ein "Lebensabschnittsprogramm" und eine gescheiterte Ehe ein "Privatkonkurs".
Am Ende weist Mika aber doch einen Ausweg aus der selbstverschuldeten Frauenunmündigkeit heraus: Verantwortung für sich selbst übernehmen. Nicht auf einen Mann warten, der einem dabei hilft. Überhaupt aufpassen, welchen Mann man sich aussucht, und über sich nachdenken. Das ist alles richtig und wichtig. Ebenso wie die Feststellung, dass von Frauen erwartet wird, dass sie Mann und Kinder vorzuweisen haben; dass es eine Diskrepanz zwischen modernem Selbstverständnis und gelebter Wirklichkeit gibt, dass man in diesen Widersprüchen verrückt werden kann und dass die Ursachen deswegen auch im privaten Beziehungsverhalten zu suchen sind.
Aber all das wird von dem lagerverhafteten Kampfgetöse übertönt. Und es wird vor allem von denen nicht gehört, die es vielleicht hören sollten. Von den jungen Frauen, die sich heute um Emanzipationsfragen wenig scheren, weil sie damit erst zu tun haben, wenn sie schon Kinder haben - und dann ist wahrscheinlich noch irgendjemand so gemein, dass er ihnen dieses Buch schenkt, von dem sie sich dann, auf einer Spielplatzbank sitzend, nachträglich beschimpfen lassen müssen.
ANTONIA BAUM
Bascha Mika: "Die Feigheit der Frauen. Rollenfallen und Geiselmentalität. Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug". C. Bertelsmann, 256 Seiten, 14,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
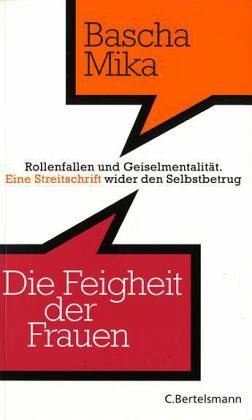





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2011