der Weltproduktion an Nahrungsmitteln für den Menschen landet auf Abfallbergen. Die Industriestaaten verklappen sogar nahezu fünfzig Prozent; Deutschland ist für bis zu zwanzig Millionen Tonnen jährlich verantwortlich. Allein der Lebensmittelmüll hat größeren Anteil am Klimawandel als der gesamte Verkehr.
Zugleich hungern heute mehr Menschen als je zuvor. Die verschwendeten Nahrungsmittel würden zwei- bis dreimal ausreichen, alle Hungernden zu versorgen. Wenn eine Gesellschaft jeden Respekt vor Lebensmitteln verloren hat, dann läuft etwas grundfalsch: Diese Feststellung steht am Beginn des Buches über die "Essensvernichter" von Stefan Kreutzberger und Valentin Thurn, das seinerseits Teil einer von vielen Verbraucherorganisationen unterstützten Kampagne ist, zu welcher Filme, aber auch Diskussionsrunden, Schulbesuche und spektakuläre Aktionen wie von Spitzenköchen zubereitete "Müllbuffets" gehören, die selbst Tom Mälzer nicht verschmähte.
Ist es nun Fanal oder bloß Modephänomen, dass zu unserer Zeit das weltrettende Kampagnenbuch gehört? Eigentümlich ist diesem Konversionsschrifttum mit NGO-Internetadressen im Anhang die holistische Perspektive: Ob es um soziale Ungleichheit, den Klimawandel, die Rechte der Frauen oder unsere Entfremdung von Natur und Ernährung geht, stets wird universalistisch argumentiert, aber gleichwohl im Partikularen angesetzt. Es gilt, das System zu ändern von unten nach oben. Im Ernährungssektor dominierte indes lange der egozentrische, qualitätsbezogene Zugang, und das mit einiger Berechtigung, gleichen doch viele Lebensmittel heute Chemiecocktails, die man ehrlicherweise als Sondermüll zu klassifizieren hätte. Neunzig Prozent der Verbraucher misstrauen inzwischen der Industrie, wie neuere Studien belegen.
In jüngerer Zeit rücken jedoch auch hier ethische Fragen in den Vordergrund. Die fatale Ausbreitung des Hungers aufgrund der Monokultur- und Gentechnik-Strategien der Nahrungsmittel-Weltkonzerne ist inzwischen ein stark debattiertes Thema. Der profundeste Angriff aufs gute Endverbrauchergewissen war zuletzt Jonathan Safran Foers Vegetarismus-Plädoyer unter dem Titel "Tiere essen" (F.A.Z. vom 13. August 2010). Es ist hierzulande im selben Verlag erschienen wie das "Essensvernichter"-Buch, das nicht nur in Appellstruktur und der Verbindung von Statistiken mit persönlichen Erfahrungen an "Tiere essen" anschließt, sondern einmal mehr den maßlosen Fleischkonsum geißelt, nämlich als "gigantische Nahrungsmittelverschwendung", weil bei der Mast ein Vielfaches an Wasser und Nährwert verbraucht werde. Auch das bevorstehende Aussterben der Fische durch Überfischung der Meere und die gigantischen "Beifang"-Mengen werden hier wie dort thematisiert.
Seltener schon hat man das Problemfeld Ernährung von der Verklappung her aufgerollt, obwohl sie vor unser aller Augen stattfindet: Allein fünfhundert Millionen Kilogramm Brot vernichtet Deutschland jährlich, meist am selben Tag erst gebacken. Ein breiteres Medienecho hat indes das Phänomen des "Containerns" - Ökoaktivisten, die von Supermarktmüll leben - gefunden. Kreutzberger und Thurn erheben denn auch gar keinen investigativen Anspruch. Ihre Absicht ist es vielmehr, alle Ansätze zu bündeln, um so die für eine soziale Bewegung notwendige kritische Masse zu erreichen, denn "wirkliche Veränderungen wird es nur geben, wenn der öffentliche Druck kontinuierlich aufrechterhalten wird".
Das Prinzip der produktiven Wiederholung setzt sich innerhalb der "Essensvernichter" fort, denn im Grunde handelt es sich um zwei ineinandergeschachtelte, sogar in verschiedenen Schrifttypen (mit und ohne Serifen) gesetzte Bücher: Kreutzberger steuert gut recherchierte Hintergrundinformationen bei, Thurn Exemplarisches aus dem Kontext der Dreharbeiten zum Film "Taste the Waste", der morgen im Kino anläuft. Keiner der beiden Autoren schwelgt in Untergangsrhetorik, ebenso wenig der Slow-Food-Gründer Carlo Petrini im Vorwort oder die deutsche Greenpeace-Geschäftsführerin Brigitte Behrens im Nachwort: kein Epitaph also, sondern ein Wachrüttelbuch voller Zuversicht in den mündigen Verbraucher, was Klaus Töpfer und Sarah Wiener schon vorab Jubelempfehlungen aussprechen ließ. Kurz: Dieses Buch-Film-Internet-Gesamtprojekt hat das Zeug dazu, der Ungeheuerlichkeit einer systematischen Nahrungsmittelvernichtung die nötige Öffentlichkeit zu bescheren. Denn so viel ist klar: Wir müssen unser Leben ändern! Es braucht dazu aber einen wuchtigen Tritt in den Hintern.
Was also läuft schief? Vieles, und das auf verschiedenen Ebenen. Das Überangebot in den Industriestaaten, wo allein die Joghurtauswahl eine "Stimmungsapotheke" darstelle, spiegele eine planlose Nachfrage, die sublimierter Lebenshunger sei. Unendliche Vielfalt und volle Regale bis zum Ladenschluss aber bedeuteten Überschuss. Viele Supermärkte entsorgten Ware kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, statt sie billiger abzugeben.
Überhaupt ist das Mindesthaltbarkeitsdatum einer der Lieblingsfeinde der Autoren: Obwohl nur eine Gütegewährleistung der Industrie, verwechselten viele Verbraucher diese Angabe mit dem nur bei Fleisch und Fisch wirklich nötigen Verbrauchsdatum. Dabei ließe sich zu Hause leicht prüfen, was verdorben sei: "Aber offensichtlich traut der Konsument seinen eigenen Sinnen - sehen, riechen, schmecken - weniger als dem Aufdruck des Herstellers." Wegwerfen konnte erst in einer von der Landwirtschaft entfremdeten Gesellschaft zum "gelernten Verhalten" werden.
Die Autoren schelten die Praxis des Handels, ganze Chargen zu entsorgen, wenn es kleinste Unregelmäßigkeiten gebe: eine einzige faule Tomate, ein einziges beschädigtes Honigglas im Gebinde. Außerdem halte der Handel rein ästhetische Normen bei frischem Obst und Gemüse aufrecht (die gerade Gurke), nachdem die EU diese unsinnigen Vorgaben im Jahre 2009 weitgehend aufgehoben habe. Normierte Früchte aber seien für gewaltige Ernteverluste verantwortlich.
Reduktion und Regionalismus sind die Zentralforderungen in diesem Manifest. Zu überdenken sei zudem das europaweite Verfütterungsverbot von Speiseresten an Schweine aus Angst vor Seuchen, welche durch korrektes Erhitzen aber ausgeschlossen werden könnten. Damit allein ließen sich fünf Millionen Tonnen Getreide einsparen. Sowohl im Handel als auch auf Konsumentenebene gebe es bereits viele gute Ansätze, die nur konsequenter wahrgenommen werden müssten: Gemüsekisten-Abos, fleischfreie Tage in Schulen und Kantinen, Selbsternteprojekte, die Bio-Tonne, das Prinzip der Tafeln, also die Abgabe des Überschusses an Bedürftige.
Düsterer sieht es beim Blick auf die Hersteller aus, die in dem Buch namentlich vorgeführt werden. Nur vier Großkonzerne kontrollierten demnach zwei Drittel des globalen Handels mit Agrarrohstoffen. Gemeinsam mit ihren direkten Kunden seien diese Konzerne "die Täter", während der Lebensmittelindustrie die Rolle des "Gehilfen" zufalle und dem Verbraucher die des "nützlichen Idioten". Auf Täterseite hinzuzufügen sei noch die "Agrarmafia" - Firmen, die die Kleinbauern auf der ganzen Welt von ihrem Saatgut abhängig machten. Hier hilft nach Ansicht der Autoren nur radikale Entglobalisierung.
Längst ist der Markt noch einen Schritt weiter: Mit Grundnahrungsmitteln wird an der Börse spekuliert, und fruchtbare Böden haben sich als rentable Kapitalanlagen erwiesen. Sowohl der "Agrarkolonialismus" als auch die diversen Formen des Lebensmittel-Spekulantentums - in diesen stärksten Kapiteln des Buches argumentieren die Autoren sehr umsichtig - führten letztlich neben der gestiegenen Nachfrage (etwa durch Biokraftstoffe) zu steigenden und dazu noch stark schwankenden Rohstoffpreisen. Das wiederum zerstöre regionale Märkte in den Entwicklungsländern. Die Verschwendung und der Hunger sind Teil dieses weltweiten Systems, das Nahrungsmittel abstrakt als Produkt betrachtet und einzig den Profit im Blick hat, bis hinunter zum Verbraucher. Was zunächst nur wie Respektlosigkeit aussah, ist in letzter Konsequenz ein monströser Tötungsvorgang.
Wenn jeder nur bereit wäre, etwas mehr für seine Lebensmittel zu zahlen und als Konsument die Strategien der marktbeherrschenden Multis zu durchkreuzen, ließe sich der Hunger selbst ohne Müllbuffets und Gemüsekisten-Abos besiegen, denn eigentlich, das ist die gute Nachricht dieses Buches, ist genug für alle da.
OLIVER JUNGEN
Stefan Kreutzberger und Valentin Thurn: "Die Essensvernichter". Warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist.
Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2011. 320 S., br., 16,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
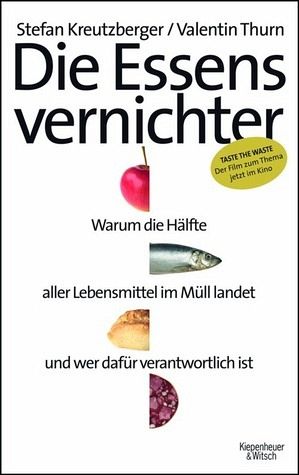










 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.09.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.09.2011