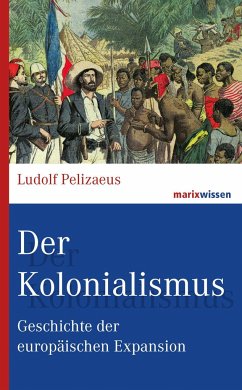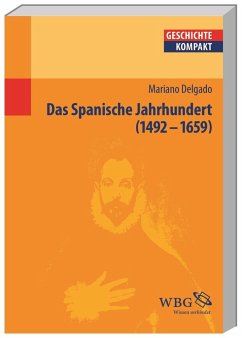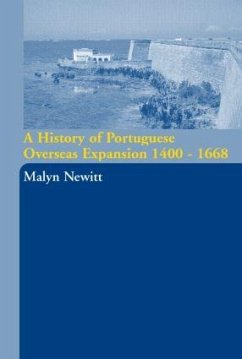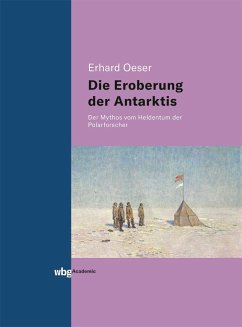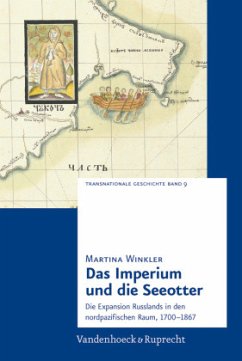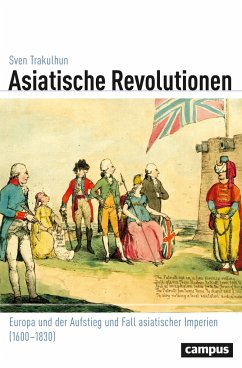Handelsniederlassungen hatten, unterworfen und unter die europäische Präsenz im Indischen Ozean einen Schlussstrich gezogen.
Aber die Verteidiger hielten stand. Mit fünf Kriegsschiffen und einem System von Sperren, welche die Zugänge zu der Halbinsel, auf der die Stadt lag, verriegelten, wehrten sie alle Angriffe des Massenheeres ab. Die Kanonen, die sich der Samorim unter Anleitung venezianischer Agenten hatte gießen lassen, wurden von Pereiras Artilleristen durch gezielten Beschuss ausgeschaltet, die Boote Kalikuts aus bequemer Distanz versenkt. Als im September eine Entsatzflotte aus Portugal in Cochin eintraf, hatte der Samorim die Hälfte seines Heeres im Kampf, durch Krankheiten oder Desertion eingebüßt und den Rückzug angetreten. Pereiras Truppe verlor nur eine Handvoll Soldaten.
Roger Crowley, der die Belagerung in seinem Buch über die Anfänge des portugiesischen Übersee-Imperiums schildert, erklärt deren Ergebnis mit der "unwiderstehlichen Stoßkraft" der Europäer. Es ist wahr, die Waffentechnik hatte in Westeuropa seit der Erfindung des Schießpulvers um 1300 einen Sprung gemacht, von dem andere Weltgegenden nur träumen konnten. Als Heinrich der Seefahrer im fünfzehnten Jahrhundert die ersten Flotillen vor die westafrikanische Küste schickte, steckte die Taktik des Kampfes mit Bronzekanonen und Eisenkugeln auf hochbordigen Schiffen noch in den Kinderschuhen.
Als Vasco da Gama 1498 die Südspitze Afrikas umsegelte, Mombasa und Malindi passierte und als erster Portugiese vor Kalikut ankerte, waren die Naus, Karacken und Karavellen, in denen die Besucher aus Übersee kamen, zu schwimmenden Festungen herangereift. Sie bewältigten, wenn auch oft nur knapp, die monatelange Passage über offenes Meer, ihre Feuerkraft brach Stadtmauern und Paläste, und ihre Laderäume fassten so viele Säcke mit Gewürzen, dass die Rendite aus dem Indienhandel auf das Sechzigfache des eingesetzten Kapitals anstieg.
Aber unbesiegbar waren die Europäer nicht. Bei Chaul, vier Jahre nach Cochin, wurde das portugiesische Flaggschiff von der Flotte des Mamluken-Sultans erobert, und als die Truppen des Vizekönigs Afonso de Albuquerque 1510 versuchten, Kalikut zu erobern, erlitten sie eine blutige Schlappe. Dennoch gewannen sie immer mehr an Boden, schlossen Bündnisse mit lokalen Mächten, dehnten ihren Einflussbereich bis nach Ceylon und Sumatra aus und säten trotz furchtbarer Massaker und Plünderungen nicht genügend Hass unter den Einheimischen, um von ihnen in einer gemeinsamen xenophoben Aufwallung wieder vertrieben zu werden.
Diese lange Erfolgsgeschichte des Kolonialismus hat andere als nur militärische Gründe. Ihnen freilich widmet Crowley in seinem süffig geschriebenen Buch leider nur wenige Absätze. Das ist schade, denn das globalhistorische Theater, in dem der Blitzkrieg im Indischen Ozean nur einen Zwischenakt bildete, war spannend genug.
Von Kleinasien aus drängte das Osmanische Reich nach Süden, wo es 1517 die Herrschaft der Mamluken von Kairo beendete, die bis dahin als Schutzmacht der Muslime Südostasiens aufgetreten waren. In Persien festigte der Klan der Safawiden, in Nordindien das junge Mogulreich sein Territorium. Alle diese Staaten waren Landmächte, denen - wenn man von den Osmanen im Mittelmeer absieht, denen Crowley vor sieben Jahren eine seiner populären Darstellungen gewidmet hat - am Flottenbau wenig lag. Für die Nationen am Westzipfel Europas dagegen war der Ozean Fluch und Chance zugleich. Dass das arme Portugal unter Heinrich dem Seefahrer als Erstes den Sprung in die Wasserwüste wagte, ergab sich fast zwangsläufig aus seiner Randlage. Der Seeweg nach Indien verhieß märchenhafte Reichtümer und das Ende des venezianischen Monopols auf den Gewürzhandel. Als Vasco da Gamas Männer mit ihrer frohen Botschaft nach Lissabon zurückkehrten, gerieten die dortigen Agenten Venedigs in Panik, und das europäische Investorenkapital begann an den Tejo zu fließen. Von hier aus flossen die Warenströme weiter nach Antwerpen und London, die Profite der Hanse versiegten, und das Mittelmeer trat von der Bühne der Weltgeschichte ab.
Crowley blendet diese größeren Perspektiven nicht gänzlich aus. Aber wie in seinen früheren Büchern spricht er lieber von Schlachten und Belagerungen, von großen Männern, die die Geschichte machen, und kleinen, die sie erleiden. Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht Afonso de Albuquerque, der zweite Gouverneur von Portugiesisch-Indien, der in seinen Briefen an König Manuel I. die Vision eines zusammenhängenden Kolonialreichs von Ostafrika über Sansibar und Hormuz bis nach Malakka entwickelte. Aber Albuquerque war auch ein Haudegen, der in den Straßen Kalikuts kämpfte, vor Goa einer vielfachen Übermacht standhielt, Überläufer verstümmeln und Frauen und Kinder massakrieren ließ.
Mit anderen Worten, er war alles, was ein Erzähler wie Roger Crowley braucht, um seiner Schilderung eines wenig ruhmvollen, dafür umso folgenreicheren Raub- und Eroberungszugs Farbe und Schärfe und einen Hauch individueller Tragik zu geben. Die Tragik der Populärgeschichtsschreibung besteht darin, dass sie den Hunger, den sie weckt, nicht stillen kann. Man kommt aus diesem Buch wie ein Taucher aus einem Schatzschiff. Da unten liegt so vieles in der Tiefe, was sich zu bergen lohnte. Aber der Sauerstoffvorrat reicht nicht, um es zu holen. Für künftige Expeditionen gibt es also noch genügend Arbeit.
ANDREAS KILB
Roger Crowley: "Die Eroberer". Portugals Kampf um ein Weltreich.
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Hans Freundl. Theiss Verlag, Darmstadt 2016. 432 S., Abb., geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.04.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.04.2016