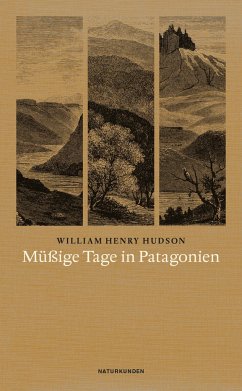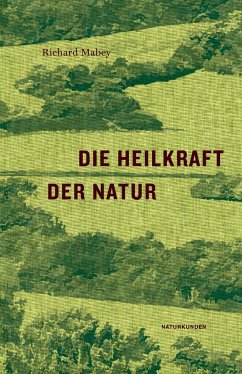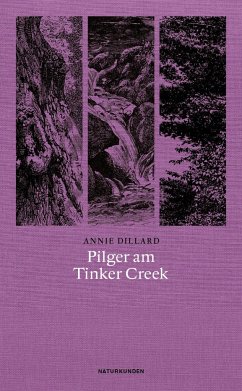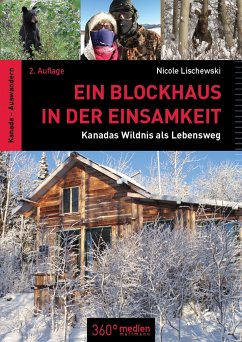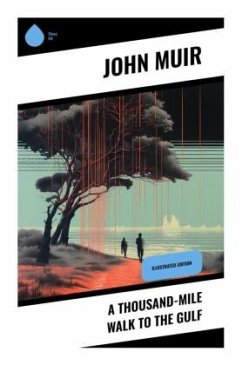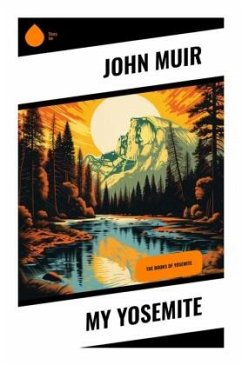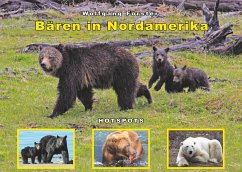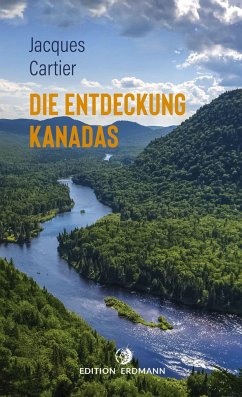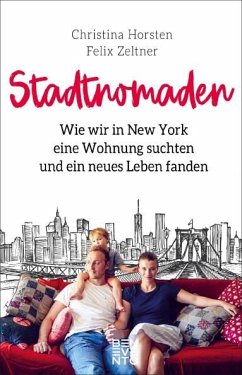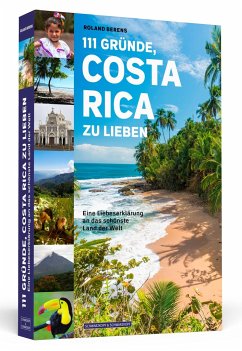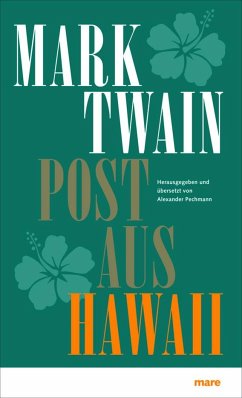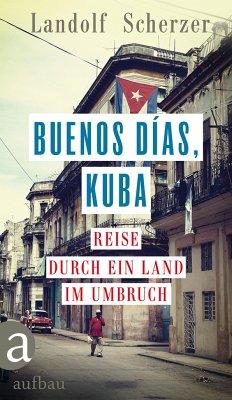Monument in Utah, einem damals noch relativ wenig erschlossenen Park mit spektakulären Steinbögen. In "Desert Solitaire" feiert er die Schönheit dieser Landschaft und beklagt die Zerstörung ihres Zaubers.
Als Ranger kümmert sich Abbey um drei Zeltplätze mit Plumpsklos, sammelt und verbrennt Müll, warnt Besucher, falls schlechtes Wetter die Straße unbefahrbar macht, und beantwortet Fragen: "Gibt es hier gefährliche Tiere, Ranger?" "Nur Touristen." Von April bis September lebt er fern der Welt. Der NPS stellt ihm einen Wohnanhänger mit Gasherd, Gaskühlschrank und schrecklich lautem Stromgenerator, in der Sommerhitze schläft es sich aber besser unter freiem Himmel. Vor allem hat Ranger Abbey viel Zeit, die Natur zu erkunden.
Wenn die unscheinbare Kliffrose erblühe, schreibt er, komme sie "herrlich wie ein Schwan daher, wie eine Jungfrau, und die zerzausten Zweige verschwinden hinter dichten Büscheln cremeweißer oder blassgelber Blüten". Und die Sturzflut, die nach dem Gewitter durch das Bachbett rauscht, sieht für ihn aus "wie eine dicke sämige Suppe, so sämig wie Bratensoße, angedickt mit Schlamm und Sand, aufgeschlagen mit Fetzen blutigen Schaums".
Das zentrale Anliegen, für das Abbey entschlossen eintritt, ist der Schutz der Wildnis gegen den Fortschritt. Denn eine "Zivilisation, die das wenige, das noch von der Wildnis übrig ist, die Reserve, das Ursprüngliche, zerstört, schneidet sich von ihren Wurzeln ab und verrät das Prinzip der Zivilisation selbst". Abbey verdeutlicht das Ausmaß dieses Verlusts, wenn er im längsten Kapitel des Buchs von einer Bootstour durch den Glen Canyon berichtet, die er mit einem Freund unternahm, bevor der Colorado River aufgestaut wurde und der Canyon unter dem künstlich geschaffenen Lake Powell verschwand. Seinen Arbeitgeber nimmt er von der Kritik nicht aus, ganz im Gegenteil. Er wirft dem NPS vor, mit dem Bau von mehr und mehr Straßen durch die Parks nur Besucherzahlen zu steigern - als ob die Natur sich vom Auto aus erleben lasse.
Nach "Desert Solitaire" wurde Abbey in Zeiten des gewandelten Umweltbewusstseins zum gefragten Autor. Das Buch enthält sein trotziges Bekenntnis, den verhassten Straßenbau im Arches-Park sabotiert zu haben, indem er Streckenmarkierungen der Landvermesser wieder entfernte. Daran schloss 1975 sein erfolgreichster Roman an: "Die Monkey-Wrench-Gang" schickt Ökosaboteure in den Kampf um die Wildnis. Die Auflagen beider Bücher gingen in die Hunderttausende.
Jetzt liegt "Desert Solitaire" erstmals auf Deutsch vor. Die Ausgabe verzichtet auf ein Nachwort zur Einordnung von Autor und Werk. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Zum einen war Abbey als Autobiograph ein Mythenmacher. In der Einleitung schreibt er, der Großteil des Buchs sei seinem Tagebuch entnommen, "manchmal direkt und unverändert". Schon an der Verdichtung der beiden Ranger-Einsätze von 1956/57 zu einem einzigen Sommer zeigt sich jedoch, dass er nicht einfach abgetippte Tagebuchtexte zusammenfügt.
Man liest manches anders, wenn man weiß, dass Abbey die neue Stelle antrat, kurz bevor im April 1956 sein erster Sohn geboren wurde. Im zweiten Jahr waren Frau und Kind mit ihm in der Wüste. Zur Bootsfahrt durch den Glen Canyon brach er wenige Wochen nach der Geburt des zweiten Sohns auf. Das Buch, das den Söhnen gewidmet ist, blendet die Familie aus, um von Einsamkeit in der Wüste und Männerfreundschaft auf dem Fluss zu erzählen.
Ein Nachwort wäre außerdem wünschenswert, weil Abbey nicht nur ein populärer, sondern auch ein umstrittener Autor war. Wie er mit ökologischem Radikalismus die Konservativen gegen sich aufbrachte, so reizte er mit Polemiken gegen Feminismus und Einwanderung die Liberalen. Während er Dämme sprengen wollte, damit Flüsse frei fließen können, riet er zu Zäunen, um Migranten abzuhalten. Während er sonst Ingenieuren, Bürokraten und Militärs misstraute und die Wildnis als Schutzraum gegen den Staat verstand, rief er nach Staat und Armee, wenn es um Grenzschutz ging, der ein simples technisch-militärisches Problem sei. Die Amerikaner sollten "den Massenzufluss weiterer Millionen von hungrigen, ignoranten, ungelernten und kulturell-moralisch-genetisch verarmten Menschen" beenden, "zumindest bis wir unsere eigenen Angelegenheiten in Ordnung gebracht haben". Solche Forderungen aus den Achtzigern sollte kennen, wer heute diesen "Klassiker" wiederentdecken will.
Der "New Yorker" hatte Abbey in der Rezension zu "Desert Solitaire" einen "guten Hasser" genannt und das als Lob gemeint wegen der Schärfe seiner Kritik an der Naturzerstörung im Zeichen von Fortschritt und Tourismus. Tatsächlich kann Abbey einen leicht faszinieren mit seinem wilden, witzigen und wütenden Stil. Aber es gibt Misstöne. Abbeys Sorge gilt bereits dem ungebremsten Bevölkerungswachstum, das er an den Indianern erläutert: Sie "überholen den weißen Mann mit einer Geburtenrate im Verhältnis von drei zu zwei". Auf Englisch fügt das Wort "outbreeding" noch einen Dreh ins Animalische hinzu, der in "überholen" fehlt und sich kaum übersetzen lässt.
Da die Zahl der Navajo, die Abbey als Beispiel wählt, stark gestiegen, ihr Reservat aber nicht gewachsen sei, könne ihr Land sie nicht mehr ernähren. Das ist der historisch grobgestrickte Gedanke, den er später in der Einwanderungsfrage auf Amerika insgesamt übertrug, wenn er etwa in einem Leserbrief an die "New York Review of Books" anmerkte, das amerikanische Boot sei voll. In "Die Einsamkeit der Wüste" lässt Abbey seine Leser wissen, sie dürften die Tugenden des Buchs nicht unabhängig von den Fehlern sehen. Wenn alles auf ganz oder gar nicht hinausläuft: Besser gar nicht.
THORSTEN GRÄBE.
Edward Abbey: "Die Einsamkeit der Wüste". Eine Zeit in der Wildnis.
Aus dem Englischen von Dirk Höfer. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2016.
344 S., Abb., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
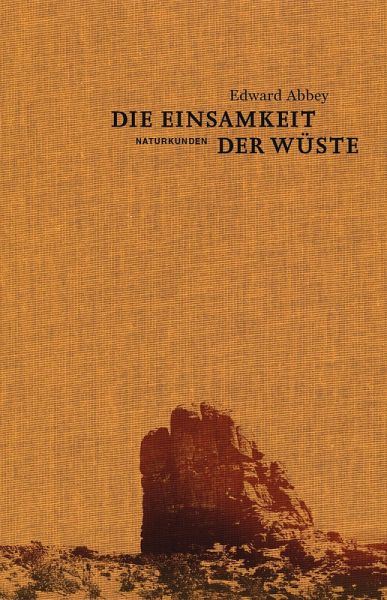




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.02.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.02.2017