unangenehmes Hintergrundrauschen. Daraus erwachsen die "einsamen Frauen", aber auch Männer, Verehrer, Künstler, Arbeiter. Sanft lullt es uns ein, wie das manchmal auch bei Proust der Fall ist.
Paveses Geschichte aber hat einen Widerhaken, der gleich zu Beginn schon greift. Dieser warnende Schatten schwebt über der Handlung und durchbricht die Lektüre fortan regelmäßig. Inmitten dieser italienischen Stadt-Serenaden wird die junge Rosetta vorbeigetragen: Das Mädchen aus gutem Hause hatte sich in einem Hotelzimmer das Leben nehmen wollen. Sie taucht künftig hier und da wieder auf. Die Freundinnen versuchen, sie ins Leben zu zerren. Rosetta ist die klassische, tragische Heldin dieses Romans, das Opfer, damit die Frauen um sie herum die eigene Einsamkeit nicht so arg spüren müssen. Rosetta führt aus, womit die anderen nur kokettieren. Pavese ist raffiniert genug, uns deshalb erst ihren Körper vorzuführen. Viel später macht er uns mit der schüchternen Frau bekannt. Da hat sich das Bild der lebensmüden Rosetta schon tief eingedrückt.
Paveses Widerhaken gegen das allgemeine Geplapper und die Oberflächlichkeit, die den Roman ja nur tarnt, umfasst aber nicht nur Rosetta, sondern auch die berichtende Clelia. Obwohl selbst Teil der Begegnungen, lässt Pavese sie stets vom Rande her erzählen, als wäre sie nicht wirklich beteiligt. Nur das Bild der lebensmüden Rosetta, die just an ihr im Hotelflur vorbeizog, "aufgedunsenes Gesicht und wirre Haare - in einem Abendkleid aus hellblauem Tüll, ohne Schuhe", hat sie seltsam berührt. Sie beginnt sogar, die Spur aufzunehmen, um herauszubekommen, was Rosetta bewog, sich dem Tod zuzuwenden. Clelia ist erfolgreiche Schneiderin in Rom. Ihre Geburtsstadt Turin, wo die Leben in Sackgassen geraten sind, besucht sie nur der Arbeit wegen. "Die einsamen Frauen" ist also auch eine Heimkehrer-Geschichte, nur anders aufgezäumt; nicht Krieg, sondern der Erfolg in einer mondänen Welt verändert Clelias Sicht auf die Menschen und schärft ihren Sinn fürs Kleinkarierte, das sie flieht und zugleich sucht: Turin bietet nicht zuletzt auch für die selbstbewusste Clelia eine Bühne.
Bis hierhin beschriebe dieser Roman wohl kaum mehr als ein winterliches Kammerspiel: Es wechseln die Partner, die Unterkünfte, die Gesprächsthemen. Pavese, der selbst in Turin aufwuchs, sich den liberalen und antifaschistischen Traditionen der Stadt stets verbunden fühlte und als Lektor beim Einaudi-Verlag arbeitete, hat mit ungeniertem Blick Unterhaltungen mitgeschnitten, die Neugier auf den Gesichtern erfasst und in die Sätze seiner vielen Figuren klar eingearbeitet. Er unterbricht sie nur, wenn Clelia denkt.
Hier aber liegt die Tiefe dieses Romans. Denn Clelia verfügt über eine besondere, selten gewordene Eigenschaft: Sie ist sich tatsächlich selbst genug, ihr einziges Laster "ihre Lust am Alleinsein", und man glaubt es ihr. Dies hebt sie von allen ab und rückt auch die Welt, die durch sie hindurchzieht, in eine kühle Ferne, in der man mit Freude Feinheiten an anderen bemerkt: "Rosetta hörte zu, leicht lächelnd, mehr mit dem Mund als mit den Augen. So lächelte Momina, wenn sie über jemanden urteilte." Diese ausdauernde Erzählperspektive mit Leidenschaftslosigkeit zu verwechseln wäre also ein großer Irrtum.
Vielmehr wächst in ihrem Banne eine reizbare Lakonik, die einzelnen Absätzen Echowirkung verleiht. Und so lässt sich unaufhaltsam auch noch über sechzig Jahre nach Entstehung dieses Romans eine magische Melancholie in dieser winterlichen Turiner Erzählung nieder. Gepaart ist sie mit Clelias forscher Freude an Frauen wie Männern, die prompt in Verachtung überwechseln kann. "Er lachte amüsiert und versuchte, mich zu küssen. Ich hob die Hand, und er küsste diese." Immer noch wirkt dieser Roman deshalb sehr modern. Die Vorgänge der Vereinzelung hat er längst hinter sich. Clelia erzählt davon ohne katastrophisches Bewusstsein, ja sogar ohne zu psychologisieren. Umso stärker treten sie hervor.
Warum Pavese seinen Ruf als Begründer einer modernen italienischen Literatur gerade auch in den "einsamen Frauen" bestärkt, beleuchtet die Literaturkritikerin Maike Albath in ihrem ausführlichen, klugen Nachwort. Sie lenkt das Augenmerk auch auf den gesellschaftlichen Impetus, den dieser Roman - gerade im engagierten Umfeld von Einaudi - neben allem anderen zu realisieren hatte: Paveses Idealisierung einfacher Etablissements, in denen sich Clelias gelangweilte Freunde Vitalitätszufuhr erhoffen; überhaupt: seine großartige Architektur der Räume. Dieses Porträt, das auch über Paveses Selbstmord und mögliche Bewegmomente nicht schweigt, runden diese schöne Ausgabe ab. Gründe genug also, Pavese neu zu entdecken.
ANJA HIRSCH
Cesare Pavese: "Die einsamen Frauen". Roman. Aus dem Italienischen übersetzt von Maja Pflug. Mit einem Nachwort von Maike Albath und zwei Briefen von Italo Calvino und Cesare Pavese. Claassen Verlag, Berlin 2008. 206 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
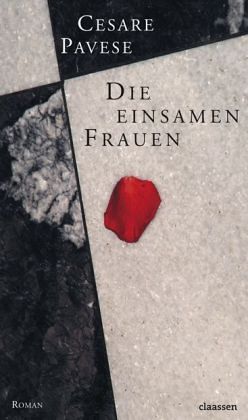




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.09.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.09.2008