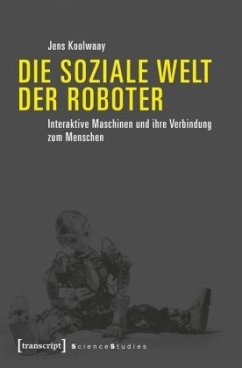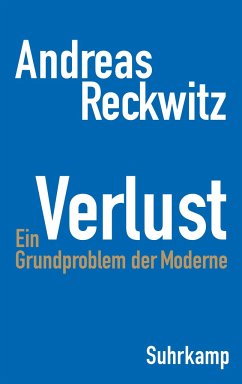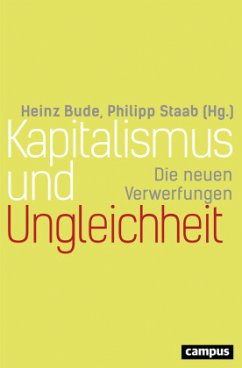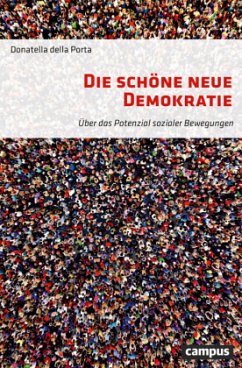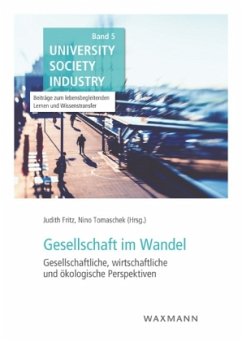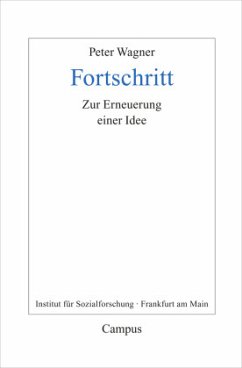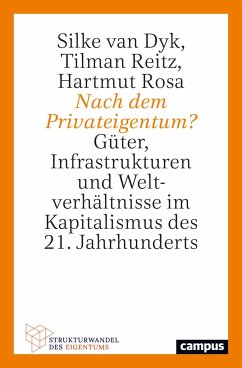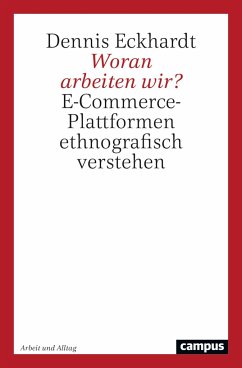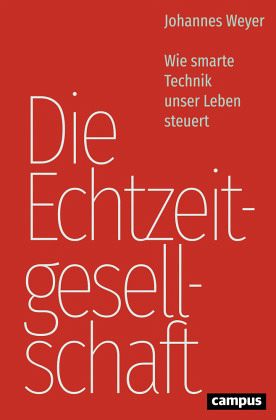
Die Echtzeitgesellschaft
Wie smarte Technik unser Leben steuert
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
29,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Alles in EchtzeitIn den vergangenen 20 Jahren haben wir eine umfassende Digitalisierung unseres Alltags, des öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt erlebt. Alles scheint sich zu beschleunigen und zu verdichten. Die rapide Veränderung des Lebens ist im Grunde nur mit den Umbrüchen im Zeitalter der Renaissance oder der Industrialisierung des 18. und 19. Jahrhunderts vergleichbar.Viele Prozesse finden mittlerweile in Echtzeit statt, gestützt auf große Mengen verfügbarer Daten. Planen und Handeln fallen in eins. Das Leben in der Echtzeitgesellschaft scheint zwar weniger riskant und besser p...
Alles in EchtzeitIn den vergangenen 20 Jahren haben wir eine umfassende Digitalisierung unseres Alltags, des öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt erlebt. Alles scheint sich zu beschleunigen und zu verdichten. Die rapide Veränderung des Lebens ist im Grunde nur mit den Umbrüchen im Zeitalter der Renaissance oder der Industrialisierung des 18. und 19. Jahrhunderts vergleichbar.Viele Prozesse finden mittlerweile in Echtzeit statt, gestützt auf große Mengen verfügbarer Daten. Planen und Handeln fallen in eins. Das Leben in der Echtzeitgesellschaft scheint zwar weniger riskant und besser planbar, doch die Spielräume für flexibles Handeln werden zunehmend enger.Johannes Weyer geht in diesem Buch den drängenden Fragen an die Digitalisierung und die Beschleunigung unserer Lebenswelt nach: Lassen sich die datengetriebenen Prozesse überhaupt noch beherrschen? Und wie könnte eine politische Steuerung der Echtzeitgesellschaft aussehen?
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.