Nicht lieferbar
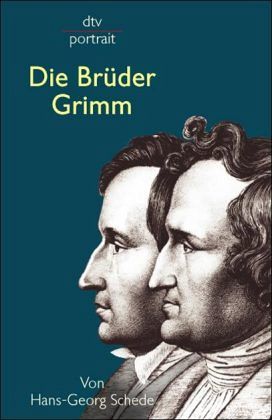
Die Brüder Grimm
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Auf knapp 200 Seiten wird der Leser mit dem Leben und Werk der Brüder Grimm vertraut gemacht. Das Buch teilt sich in neun Kapitel: Kindheit und Jugend, Die Studienzeit, Im Königreich Westfalen, Nationale Hoffnungen, politische Enttäuschungen, Zwischenbetrachtung, Als Bibliothekare in Kassel, Die Göttinger Zeit, Die Göttinger Sieben und Berlin. Das Buch ist sehr angenehm zu lesen: Hochwertiges Papier, vierfarbiger Druck, viele Bilder und Infokästchen mit Zitaten tragen dazu bei. Abgerundet wird das Büchlein mit einer Zeittafel (Jacob und Wilhelm getrennt), einer aktuellen Bibliographie und einem Register. Für alle, die sich mit dem Leben der Märchensammler und Sprachforscher befassen möchten, sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Daß das Preis-Leistungsverhältnis spitze ist, merkt man schon nach dem ersten Durchblättern.
Jacob und Wilhelm Grimm waren bedeutende Gelehrte ihrer Zeit. Berühmt wurden sie durch die 'Kinder- und Hausmärchen', die bis heute zur Weltliteratur gehören.
Jacob und Wilhelm Grimm, 1785 bzw. 1786 in Hanau geboren, waren zeit ihres Lebens in einer Arbeits-, Forschungs- und Lebensgemeinschaft verbunden. Sie studierten gemeinsam, wurden beide Professoren in Göttingen und als Mitglieder der »Göttinger Sieben« 1837 aus ihrem Lehramt entlassen.
Später wurden beide Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin; Jacob engagierte sich 1848 als Abgeordneter im Paulskirchenparlament.
Jacob und Wilhelm Grimm, 1785 bzw. 1786 in Hanau geboren, waren zeit ihres Lebens in einer Arbeits-, Forschungs- und Lebensgemeinschaft verbunden. Sie studierten gemeinsam, wurden beide Professoren in Göttingen und als Mitglieder der »Göttinger Sieben« 1837 aus ihrem Lehramt entlassen.
Später wurden beide Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin; Jacob engagierte sich 1848 als Abgeordneter im Paulskirchenparlament.



