Bücher, verspricht ironischerweise eine ganze Kultur und eine Metaphysik dazu. Und dann sind es gerade einmal fünfundneunzig Seiten.
Die aber haben es in sich. Nádas erzählt scheinbar kalt und beiläufig die kargen Erlebnisse eines Heranwachsenden in einem Budapester Villenviertel: Der große Garten mit einem blasierten Nachbarsnymphchen, die herrschaftlichen Zimmer, die mittelmäßig bewältigten Hausaufgaben, die öde Abfolge der Tage mit der primitiven und herrschsüchtigen Großmutter, der stets zum Büro hin und her eilende Vater voller Flüchtigkeit; dazu die Mutter, die ihren Sohn zwar zärtlich zu lieben scheint, aber im Staatsapparat zu beschäftigt ist für eine wirkliche Erziehung. Nádas schildert hier keine späthabsburgische Idylle im Geiste Ferdinand von Saars, sondern den Alltag der "neuen Klasse", die nach der kommunistischen Machtübernahme in den alten Fabrikantenvillen auf den Hügeln der ungarischen Hauptstadt residierte und das Land nicht nur im stalinistischen Regime bis 1956 an den Abgrund manövrierte.
Provokant muss 1967 schon der Beginn gewirkt haben, in dem Nádas keinen kommunistischen Heldenspross, sondern einen unangenehmen und dazu noch feigen Sadisten schildert: Der Knabe prügelt den Familienhund mit einer Gartenhacke tot - aus Langeweile, aus allgemeiner Lieblosigkeit vielleicht auch. In der neu errungenen, recht eigentlich strindbergschen und streng von Ritualen geregelten Bürgerlichkeit engagiert sich die Funktionärsfamilie gegen den erbitterten Widerstand der praktischen Oma ein einfältiges, frommes Hausmädchen. In fortlaufend nüchternem und gefühlsarmem Tonfall, der bei aller Detailgenauigkeit sichtlich an Hemingway geschult ist, schildert der Autor das präpubertäre Verhalten des Sohns des Hauses: Er belauert die nackte Szidike im Bad, lässt sie von der Oma kujonieren und zerrupft als Provokation die Hausbibel, bis das fromme Mädchen eingreift und das dampfende Bügeleisen auf einem Nachthemd vergisst.
Damit ist sie einerseits gefeuert, andererseits hat sie dabei die Bibel der gottlosen Leute mitgehen lassen - und wusste nicht, dass unter ihr die Mutter einst unter Lebensgefahr kommunistische Kassiber versteckt hielt und darum ans verachtete Buch sentimental gebunden ist. Solche Details über Menschen, die von mutigen Widerständlern zu kalten Henkern mutierten, verleihen der Personenschilderung Glaubwürdigkeit. Genau wie die Erwähnung zweier höchst rarer Orangen, die - nach der Phantasie der Mutter - Genosse Rákosi dem Jungen wie ein neuer Weihnachtsmann geschenkt haben soll.
Am erbarmungslosen Ende ist die Familie der neuen Herren unfreiwillig zu echten Patrons mutiert, Szidike landet wieder in dreckiger Armut auf dem Land, und aus dem Erzähler kann wohl nichts anderes mehr werden als ein emotionsloser Widerling. Kein Wunder, dass Nádas durch diese Studie, die unmerklich Lebenslügen der kommunistischen Oberschicht bloßlegt, unliebsam auffiel. Die Bibel wird hier - ohne jede religiöse Konnotation - nicht zum überkommenen Symbol stumpfer Volksfrömmigkeit, wie das auch nach dem Aufstand von 1956 die staatliche Propaganda sah, sondern zum Inbegriff menschlicher Gefühle, für die im kalten Gehäuse der Ideologie kein Platz mehr ist.
Für die Leser ist die exakte und gebührend lakonische Übersetzung dieses Frühwerks ein Glücksfall, zeigt sie uns doch den damals zwanzigjährigen Schriftsteller als veritables Junggenie. Darüber hinaus hatte Nádas mit der detaillierten Schilderung von Alltagsgefühlen auch Stil und Thema für sein monumentales, nicht zu Unrecht mit Proust verglichenes "Buch der Erinnerung" gefunden. Wen diese kondensierte Minibibel fasziniert, der sollte getrost in den Kosmos von Péter Nádas eintauchen.
DIRK SCHÜMER
Péter Nádas: "Die Bibel". Erzählung. Aus dem Ungarischen von Ruth Futaky. Berlin Verlag, Berlin 2009. 95 S., geb., 18,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
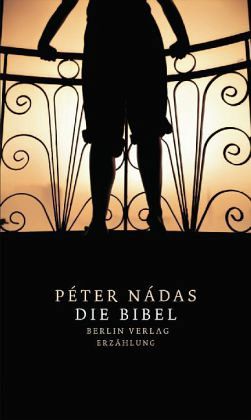





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.04.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.04.2010