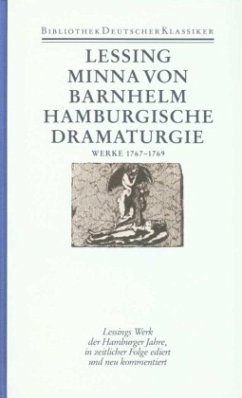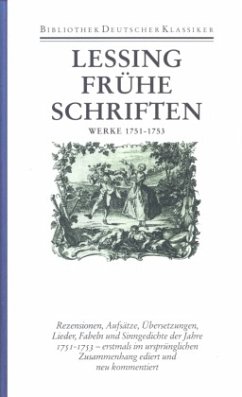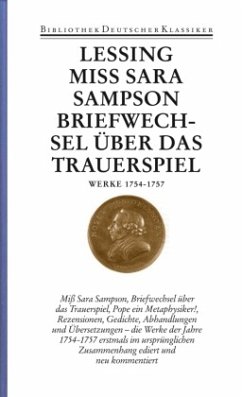er kümmerte sich um den römischen "Gesellen" und korrigierte das Schicksal, führte ihn in die Weimarer Gesellschaft ein, schickte ihn in Begleitung des Herzogs nach Berlin, so dass der schlendernde Fußreisende zum Professor der Theorie der schönen Künste, "Königlich Preußischen Hofrat" und Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften aufsteigen konnte. Der "Wilhelm Meister" porträtiert ihn in der Figur des Laertes: Wenigstens diesmal blieb da kein Opfer auf der Strecke.
Doch nicht die glimpfliche Karriere, sondern die frühen Katastrophen machten den "jüngsten deutschen Klassiker" interessant. Erst wenn man ihn, wie auch seine neuesten Herausgeber, aus dem "Schatten Goethes" herausholt, leuchtet das dunkle Licht seiner Melancholie. Das "passive" oder "Grenz-Genie" (so Jean Paul über seinen Entdecker) wurde zum Kronzeugen für das gewöhnliche Unglück seines Jahrhunderts, das doch das Glück der Menschheit auf seine Fahnen geschrieben hatte. Und der Unglückliche selbst schwang eine solche Fahne, obwohl die "Höllenfahrt der Selbsterkenntnis" ihn immer wieder zwischen die "Sonderbaren Zweifel und Trostgründe eines hypochondrischen Metaphysikers" (so einer seiner Titel) hin und her warf; notwendiges Unglück, prinzipielle Unzufriedenheit mit sich und der Welt, Seelenlähmung. "Uralt" wirkte er deshalb, erklärte Peter Handke und kehrte so Goethes Rede vom "jüngeren Bruder" um. Buchstäblich von unten, aus dem Untergrund kindlicher Schäden, die er erstmals bis ins Kleinste analysierte, als Therapeut des eigenen Unglücks, wird Moritz zum Anwalt der Aufklärung und zu ihrem entdeckerischen Pionier auf vielen Gebieten. Fast überall ist der Leidensdruck spürbar. Was der Autobiograph wahrnimmt, sind "oft nichts als Zwecklosigkeit, abgerissene Fäden, Verwirrung, Nacht und Dunkelheit". Das ist noch milde gesagt, vergleicht man damit die Fremdheits-, Kleinheits-, Vernichtungs- und Zerstückelungsphantasien, die Anton Reiser etwa angesichts einer Hinrichtung befallen - und Moritz als Meister des schwarzen Stils zeigen. Umso beschwörender meldet sich die Sehnsucht nach der verlorenen Teleologie: "Die Zwecklosigkeit verliert sich allmählich, die abgerissenen Fäden knüpfen sich wieder an, das Untereinandergeworfene und Verwirrte ordnet sich - und das Mißtönende löset sich unvermerkt in Harmonie und Wohlklang auf." Für den fragmentarischen "Anton Reiser" blieb das ein Wunsch. Seine Lebensaufgabe reichte der Autobiograph an den Pädagogen und Freimaurer, an den Popularphilosophen und Linguisten, vor allem aber an den Theoretiker einer autonomen Ästhetik weiter. Und an die moderne Philologie. Denn auf ihre Art leidet auch sie noch unter der Zerrissenheit Reisers und seines Autors. Die Unübersichtlichkeit und Zerstückelung von Moritz' Schriftstellerei sucht ihresgleichen. Kein Wunder, dass seit zwanzig Jahren der Ruf nach dem ganzen Moritz ertönt, nach einer großen, womöglich historisch-kritischen Ausgabe. Von dreißig Bänden war die Rede, aber noch sind, bei aller Sympathie, nicht einmal die bibliographischen Bestandsaufnahmen abgeschlossen. Die wohl noch langwierige Wartezeit füllt jetzt eine zweibändige Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlags (F.A.Z. vom 24. Januar 1998). Sie bietet den ganzen Moritz immerhin in Auswahl, so dass alle seine Interessenfelder aufscheinen. Und sie entschädigt für den Kompromiss durch editorische Sorgfalt und beträchtliche kommentatorische Energien, womit sie auch ihre gediegenen Vorgänger übertrifft.
Der Band, den Heide Hollmer und Albert Meier jetzt vorlegen, enthält die am besten bekannten Texte, den "Anton Reiser" und die "Hartknopf"-Romane sowie wichtige Stücke aus dem "Magazin zur Erfahrungsseelenkunde" (mit den übrigen "Dichtungen", den lyrischen und dem dramatischen "Blunt", ist kein Staat zu machen). Erstmals unter einem Dach vereint sind damit die Zeugnisse, die den Ruhm des Erfahrungsseelenkundlers und Anthropologen Moritz ausmachen. Das ist bequem, auch wenn man deshalb keineswegs auf die schönen Reprint-Ausgaben des "Magazins" von Anke Bennhold-Thomsen und Alfredo Guzzoni (1978/79) oder Petra und Uwe Nettelbeck (1986) verzichten kann. Von den zehn Bänden des "Magazins", der ersten deutschen psychologischen Zeitschrift, finden gerade einhundert Seiten Platz, und das sind noch nicht einmal alle Beiträge von Moritz selbst. Aus der Fundgrube ist notgedrungen ein wohlgeordnetes (und vorzüglich kommentiertes) Sortiment geworden.
Da steht nun also Anton Reiser, der empfindsame Selbstentblößer, der quietistisch-pietistisch geschulte (und gequälte) Selbstbeobachter, der Selbstaufklärer und Arzt an der eigenen Seele, neben dem Archiv, das auch seine Leiden einer Schule des Menschenstudiums "für Gelehrte und Ungelehrte" einfügt. "Fakta, und kein moralisches Geschwätz" - so lautete die Devise, die Moritz "mit Zittern" dem Unternehmen voranstellte. Er löste eine Lawine aus, die sich nicht lange von der Kategorientafel "Seelennaturkunde, Seelenkrankheitskunde, Seelenzeichenkunde, Seelendiätetik" bändigen ließ. Psychopathologisches in jeglicher Form und namentlich parapsychologische Erfahrungsberichte wurden herangeschwemmt. Es kommt darüber zu einer scharfen Kontroverse zwischen Moritz und dem Ersatzherausgeber Pockels, dem er das "Magazin" während seiner italienischen Reise überlassen hatte. Im Gestus kämpferischer Aufklärung machte Pockels Front gegen "Aberglauben" und "Schwärmerei". Moritz hingegen beharrte auf "Unparteilichkeit" und wollte sich seine Neugier auf den individuellen Fall von keinem eifernden "Glaubensreformator" nehmen lassen. Sein Bekenntnis (man findet es leider nur im Kommentarteil unseres Bandes): "Der kühne Fuß des Menschen steigt in die tiefen Schachten der Erde hinab, und unser denkendes Wesen sollte es nicht wagen, in seine eigenen Tiefen herabzusteigen . . . Auf dem Punkte, wo unser Wesen sich vollendet, darf es wahrlich nicht vor sich selbst erschrecken . . . denn nichts ist wahrhaft schrecklich als der Irrtum, welcher das Schreckliche erzeugt." Also doch ein "Schreckensmann" - nur etwas anders, als es Arno Schmidt gemeint hatte.
HANS-JÜRGEN SCHINGS.
Karl Philipp Moritz: "Dichtungen und Schriften zur Erfahrungsseelenkunde". Herausgegeben von Heide Hollmer und Albert Meier. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1999. 1361 S., geb., 178,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
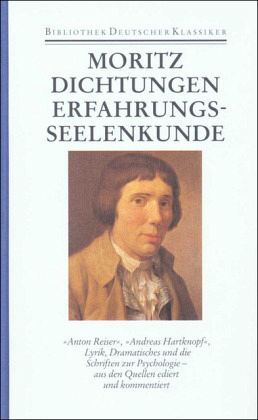




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.09.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.09.1999