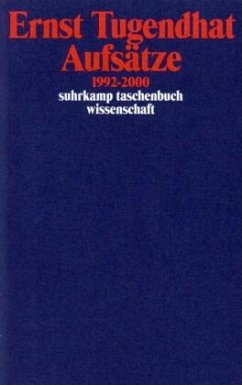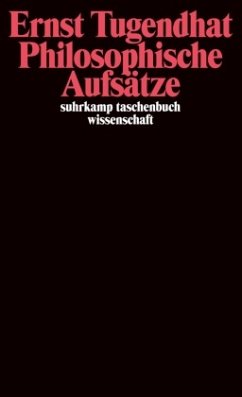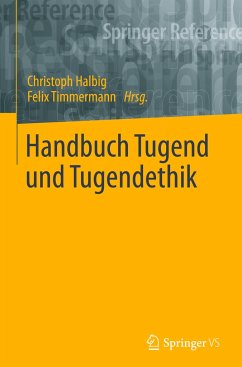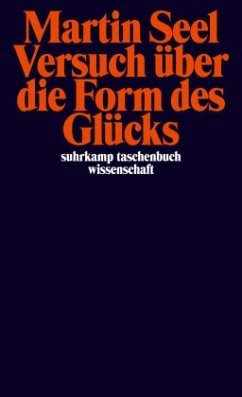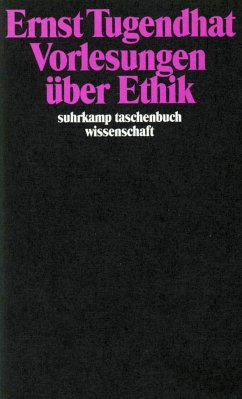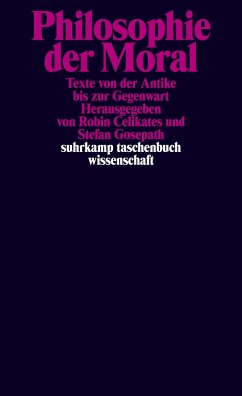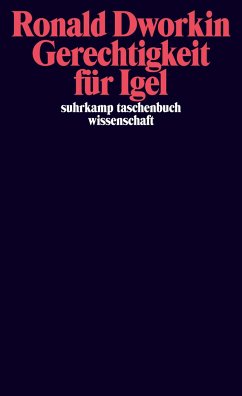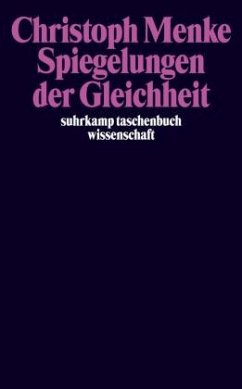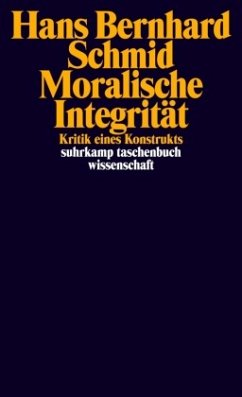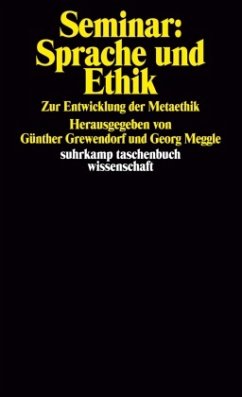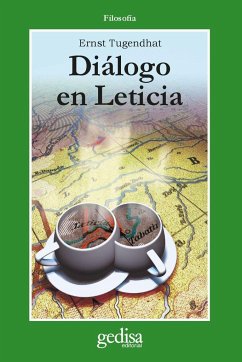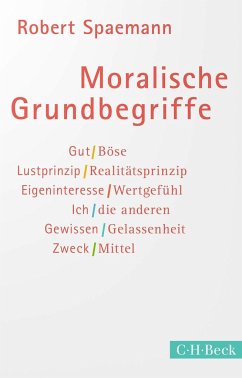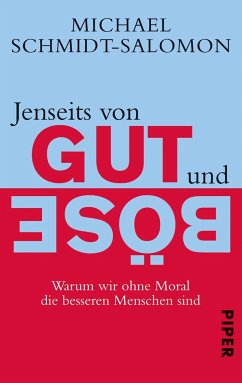Dialog in Leticia
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In Leticia, einem kolumbianischen Dorf am Amazonas, trifft der Autor auf einen alten Herrn aus Santo Domingo, der ihn in ein Gespräch über die Grundlagen der Moral verwickelt. Den Ort gibt es wirklich, der alte Herr und das Gespräch dagegen sind fiktiv. Der Dialog entzündet sich zunächst an Tugendhats bisheriger Moralphilosophie, insbesondere am Begründungsbegriff, den er in seinen Vorlesungen über Ethik entwickelt hat. Moralische Normen, so erklärt der alte Herr, seien per definitionem Handlungsregeln, die als begründungsbedürftig angesehen werden, aber sie können nicht an und für...
In Leticia, einem kolumbianischen Dorf am Amazonas, trifft der Autor auf einen alten Herrn aus Santo Domingo, der ihn in ein Gespräch über die Grundlagen der Moral verwickelt. Den Ort gibt es wirklich, der alte Herr und das Gespräch dagegen sind fiktiv. Der Dialog entzündet sich zunächst an Tugendhats bisheriger Moralphilosophie, insbesondere am Begründungsbegriff, den er in seinen Vorlesungen über Ethik entwickelt hat. Moralische Normen, so erklärt der alte Herr, seien per definitionem Handlungsregeln, die als begründungsbedürftig angesehen werden, aber sie können nicht an und für sich begründet werden, sondern sie sind gegenüber den Betroffenen zu begründen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht es um den Gerechtigkeitsbegriff und den moralischen Universalismus, um Sitten und Konventionen, um moralische Motive und schließlich auch um die »Blutrünstigkeit« der Moral: Die Moral der Herzensgüte wird als hölzernes Eisen verworfen. Am Ende des Gesprächs wenden sie sich dem Problem der Korruption in modernen Gesellschaften zu und erwägen den Vorschlag, Korruption zu entmoralisieren und nur durch externe Sanktionen zu unterbinden.