Nicht lieferbar
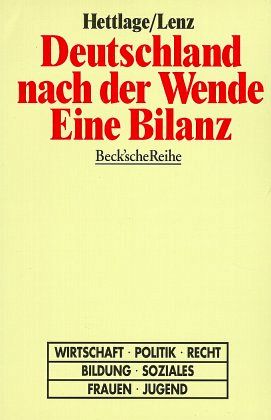
Broschiertes Buch
Deutschland nach der Wende
Eine Zwischenbilanz
Mitarbeit: Hettlage, Robert; Lenz, Karl
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Deutschland nach der Wende
Dr. Dr. Robert Hettlage ist Professor für Soziologie am Lehrstuhl für Soziologie der Universität Regensburg.
Produktdetails
- Beck'sche Reihe 1114
- Verlag: Beck
- 1995
- Deutsch
- Gewicht: 250g
- ISBN-13: 9783406392146
- ISBN-10: 3406392148
- Artikelnr.: 06051067
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.10.1995
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.10.1995Goldener Osten
Zur inneren Vereinigung Deutschlands / Wohlstand als großer Integrator
Robert Hettlage, Karl Lenz (Herausgeber): Deutschland nach der Wende. Eine Bilanz. Beck'sche Reihe 1114. Verlag C. H. Beck, München 1995. 270 Seiten, 24,- Mark.
In einer Beziehung hat sich nach fünf Jahren deutscher Einheit wenig geändert: Der Osten weiß so gut wie alles über den Westen, der Westen weiß so gut wie nichts über den Osten. Anders gesagt: Im Osten weiß man vieles besser. Es hat sich also doch etwas geändert. Im Osten so viel, daß es dort heute schon schwerfällt, sich an den Osten von vorgestern zu erinnern. Auch deshalb fällt es im Westen immer leichter, nichts über den Osten wissen zu müssen.
Im
Zur inneren Vereinigung Deutschlands / Wohlstand als großer Integrator
Robert Hettlage, Karl Lenz (Herausgeber): Deutschland nach der Wende. Eine Bilanz. Beck'sche Reihe 1114. Verlag C. H. Beck, München 1995. 270 Seiten, 24,- Mark.
In einer Beziehung hat sich nach fünf Jahren deutscher Einheit wenig geändert: Der Osten weiß so gut wie alles über den Westen, der Westen weiß so gut wie nichts über den Osten. Anders gesagt: Im Osten weiß man vieles besser. Es hat sich also doch etwas geändert. Im Osten so viel, daß es dort heute schon schwerfällt, sich an den Osten von vorgestern zu erinnern. Auch deshalb fällt es im Westen immer leichter, nichts über den Osten wissen zu müssen.
Im
Mehr anzeigen
Westen hat man die Veränderungen ohnehin stets als zwangsläufigen Weg zur "Angleichung" registriert, als Modernisierung, die dazu führen werde, daß in Deutschland "einheitliche" Lebensverhältnisse herrschten. Im stillen dachte man dabei freilich nicht nur an westliche, sondern an die eigenen, vertrauten, eingespielten Verhältnisse. Nach der DDR würden eines Tages auch "Ostdeutschland" und die "fünf neuen Bundesländer" als etwas Eigenartiges verschwinden. Ständig wird also ungeduldig verglichen: Wo ist es besser, wo schlechter; wer verdient mehr, wer weniger; wie weit ist man hier, wie schwach ist man dort. Das hat seine Berechtigung, sofern es dazu dient, am Gefälle zu messen, wo und welche Unterstützung noch zu leisten ist. Statt dessen dienen die Vergleiche aber immer wieder dazu, den Abstand zur "Vollendung der inneren Einheit" zu messen. Maßstab ist die Frage: Sind sie schon wie wir?
Auch die "Bilanz", die der Regensburger Soziologe Robert Hettlage und der Dresdner Soziologe Karl Lenz mit anderen Autoren aus Anlaß des fünften Jahres deutscher Einheit ziehen, legt bisweilen diesen Maßstab an. Allerdings ist das Buch über den Verdacht erhaben, allein aus westdeutscher Sicht zu bilanzieren. Das hieße, Neuigkeiten zu verbreiten, die keine sind. Etwa diese: "In einem gigantischen Umfang wird von den Ostdeutschen, egal welcher Altersgruppe sie angehören, ein Umlernen in beruflichen wie auch privaten Alltagsroutinen verlangt." Es gehört zu den Vorzügen des Buches, daß eine solche Erkenntnis nicht dazu dient, mangels tieferer Einsichten in Mitleid oder Überheblichkeit zu verfallen. Sie soll allein Voraussetzungen, Tempo und Leistung von "Integration" veranschaulichen, ein Wort, das in den Aufsätzen zumindest gleichberechtigt neben "Angleichung" steht und nicht nur deshalb wohltut.
Die Unterscheidung von "institutioneller" und "kultureller Integration" erlaubt es, nicht aus einer Teilperspektive - Ost oder West - zu urteilen, sondern das Ganze im Auge zu behalten. Das führt in dem Buch des öfteren dazu, daß die Theorie, nur der Osten werde mit der Einheit nach dem Bilde des Westens modernisiert und quasi im Zeitraffer angepaßt, in Frage gestellt wird.
Für die institutionelle Integration gibt es freilich keine treffendere Bezeichnung als die völlige - nahezu schon abgeschlossene - Angleichung. Hettlage erinnert daran, daß dieser Kern der Vereinigung "nicht unwesentlich ein Rechtsvorgang war". Recht setzte nicht nur Grundlagen. "Nachdem der Grundkonsens einmal gefunden und rechtlich gefaßt worden war, wurde ein Großteil des gesellschaftlichen Transformationsvorgangs im Osten Deutschlands durch fortlaufende Rechtsetzungsinitiative und daraus resultierende Rechtsfolgen angestoßen." Nur so ist zu verstehen, warum das Gefühl der Vereinnahmung, der "Kolonialisierung" und der westdeutschen Dominanz in Ostdeutschland so schnell und nachhaltig um sich griff. Vergessen scheint darüber, daß es gerade und nur diesem unspektakulären "Rechtsvorgang" zu danken ist, daß die deutsche Einheit einem Zeitdruck standhalten konnte, der die Akteure immer wieder zu überrollen drohte. (Eine Chronik zeigt am Ende des Buches die Siebenmeilenschritte der letzten fünf Jahre.)
In gewisser Weise aber bezahlte die institutionelle Integration ihre atemraubende Schnelligkeit mit der Langsamkeit "kultureller Integration". Damit ist die tatsächliche, bewußte und von Wertgefühlen getragene Verankerung von Institutionen gemeint. Werner Patzelt dürfte allerdings übertreiben, wenn er schreibt: "Im Grunde bis heute schwebt das neue System oberhalb der ostdeutschen Gesellschaft und ist mit ihr erst lose vertäut." Das mag für Parteien und andere politische Organisationen gelten. Für mehr auch nicht. Patzelt selber vermittelt mit einem Überblick über den "Reformdruck" in Deutschland außerdem den Eindruck, daß es mit der Vertäuung in der westdeutschen Gesellschaft auch nicht zum besten steht. Allenthalben sieht er "Politikblockaden", die mit der deutschen Einheit erst richtig bloßgestellt worden seien. Sie bestünden "in der reduzierten Fähigkeit unseres politischen Systems, in akzeptabler Frist verbindliche Entscheidungen herbeizuführen und durchzusetzen".
In Patzelts Kritik am Status-quo-Denken, das in diesem Falle durchaus mit Besitzstandswahrung gleichzusetzen ist, schimmert der in Ostdeutschland verbreitete Unwillen darüber mit, daß der Wende im Osten im Westen nicht einmal der Hauch einer Umorientierung gefolgt sei. Vielmehr wurde die Entwicklung im Osten von einer selbstgefälligen Bestandsaufnahme der "Kosten der Einheit" (unentwegt beschworen von Lafontaine) begleitet. Nicht sie aber, sondern andere Kosten verlangen nach neuen Rezepten: etwa die des Sozialstaats, der Industriepolitik, der Einwanderung, des Steuerrechts. Mit Patzelt kann man deshalb sagen, daß fünf Jahre nach dem europäischen Umbruch und der Wende in der DDR allenfalls über die Notwendigkeit solcher Reformen Einigkeit besteht, "keineswegs aber schon über ihre Inhalte".
Nicht nur deshalb zeigt sich der Osten Deutschlands gegenüber dem Westen schon als "moderner". Indem man hier radikal umlernen mußte, setzt man Leistungshorizonte für die Zukunft auch des Westens. Zur Bilanz der Einheit gehören deshalb Sätze wie dieser: "Die Bewohner der bisherigen Bundesrepublik müssen mittelfristig nicht nur Wohlstandsverluste akzeptieren, sondern sich neuen Leistungsanforderungen gewachsen zeigen, ohne hierauf vorbereitet zu sein." Friedrich Fürstenberg ist deshalb in seiner Zusammenfassung der wirtschaftlichen Wende keineswegs der Meinung, daß die alte Bundesrepublik und ihre Form der Sozialen Marktwirtschaft Maßstab aller Dinge sei. "Das erforderliche ,Modernisierungsniveau' läßt sich also gerade im Wirtschaftsbereich nicht aus der Geschichte der bisherigen Bundesrepublik bestimmen." Zwar bleibt der Osten auf lange Sicht an die Unterstützung aus dem Westen angewiesen. Nicht aber als einseitiger Prozeß ist dieser Transfer zu verstehen, sondern jetzt schon als Wechselspiel gegenseitigen Ansporns.
Die "Angleichung" und "Vereinheitlichung" verläuft also nicht nur nicht einseitig. Sie hat sich, weil unverbindlich, als Kategorie einer deutsch-deutschen Standortbestimmung mittlerweile als unbrauchbar erwiesen. Das gilt zudem dort, wo es um das Leben selbst geht. Wir kehren also zur "kulturellen Integration" zurück, die in dem Buch anhand des Bildungssystems, des Familienlebens und der Jugendkultur eingehender untersucht wird. In allen drei Bereichen geht die "ehemalige DDR" einen Weg, der weniger von "Verwestlichung" gezeichnet ist als vielmehr von - drohender oder tatsächlicher - Arbeitslosigkeit. Dabei sind traditionelle Werte - etwa die Anhänglichkeit der Jugendlichen an ihr Elternhaus, die Wertschätzung der Familie, die Konzentration sowohl der Männer wie auch der Frauen auf ihren Beruf - ebenso ein Zeichen von Kontinuität wie ein Mittel zur Orientierung, was nicht als "Defizit", "Rückstand" oder gar als Ausfluß einer über Generationen weitergereichten deutschen "Untertanenkultur" herabgewürdigt werden sollte. Als Mangel könnten solche Eigenständigkeiten doch nur begriffen werden, wenn sie der Wende im Weg gestanden wären. Sie waren aber Stützen des Umbruchs.
Als großer wunderbarer Integrator taucht in dieser Einheits-Bilanz indessen immer wieder der Wohlstand auf. Er ist es letztlich, der in Deutschland etwas wirklich "vereinheitlicht" und im selben Augenblick zwischen Ost und West doch eine neue Kluft geöffnet hat, die Kluft der "sozialen Ungleichheit", wie sie Heiner Geißler beschreibt. Auch sie entsteht oft in erheblichem Maße nur in der Wahrnehmung: "Aus der östlichen Ferne glänzt der Westen goldener als aus der erfahrenen Nähe. Auf der anderen Seite unterschätzen die Ostdeutschen das Niveau der Lebensbedingungen in den neuen Ländern; die Mangellage kommt ihnen drastischer vor, als diese de facto ist." Es ist wohl der schönste Erfolg der deutschen Einheit, daß nicht nur der Osten Schwierigkeiten hat, sich selber wiederzuerkennen. JASPER VON ALTENBOCKUM
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Auch die "Bilanz", die der Regensburger Soziologe Robert Hettlage und der Dresdner Soziologe Karl Lenz mit anderen Autoren aus Anlaß des fünften Jahres deutscher Einheit ziehen, legt bisweilen diesen Maßstab an. Allerdings ist das Buch über den Verdacht erhaben, allein aus westdeutscher Sicht zu bilanzieren. Das hieße, Neuigkeiten zu verbreiten, die keine sind. Etwa diese: "In einem gigantischen Umfang wird von den Ostdeutschen, egal welcher Altersgruppe sie angehören, ein Umlernen in beruflichen wie auch privaten Alltagsroutinen verlangt." Es gehört zu den Vorzügen des Buches, daß eine solche Erkenntnis nicht dazu dient, mangels tieferer Einsichten in Mitleid oder Überheblichkeit zu verfallen. Sie soll allein Voraussetzungen, Tempo und Leistung von "Integration" veranschaulichen, ein Wort, das in den Aufsätzen zumindest gleichberechtigt neben "Angleichung" steht und nicht nur deshalb wohltut.
Die Unterscheidung von "institutioneller" und "kultureller Integration" erlaubt es, nicht aus einer Teilperspektive - Ost oder West - zu urteilen, sondern das Ganze im Auge zu behalten. Das führt in dem Buch des öfteren dazu, daß die Theorie, nur der Osten werde mit der Einheit nach dem Bilde des Westens modernisiert und quasi im Zeitraffer angepaßt, in Frage gestellt wird.
Für die institutionelle Integration gibt es freilich keine treffendere Bezeichnung als die völlige - nahezu schon abgeschlossene - Angleichung. Hettlage erinnert daran, daß dieser Kern der Vereinigung "nicht unwesentlich ein Rechtsvorgang war". Recht setzte nicht nur Grundlagen. "Nachdem der Grundkonsens einmal gefunden und rechtlich gefaßt worden war, wurde ein Großteil des gesellschaftlichen Transformationsvorgangs im Osten Deutschlands durch fortlaufende Rechtsetzungsinitiative und daraus resultierende Rechtsfolgen angestoßen." Nur so ist zu verstehen, warum das Gefühl der Vereinnahmung, der "Kolonialisierung" und der westdeutschen Dominanz in Ostdeutschland so schnell und nachhaltig um sich griff. Vergessen scheint darüber, daß es gerade und nur diesem unspektakulären "Rechtsvorgang" zu danken ist, daß die deutsche Einheit einem Zeitdruck standhalten konnte, der die Akteure immer wieder zu überrollen drohte. (Eine Chronik zeigt am Ende des Buches die Siebenmeilenschritte der letzten fünf Jahre.)
In gewisser Weise aber bezahlte die institutionelle Integration ihre atemraubende Schnelligkeit mit der Langsamkeit "kultureller Integration". Damit ist die tatsächliche, bewußte und von Wertgefühlen getragene Verankerung von Institutionen gemeint. Werner Patzelt dürfte allerdings übertreiben, wenn er schreibt: "Im Grunde bis heute schwebt das neue System oberhalb der ostdeutschen Gesellschaft und ist mit ihr erst lose vertäut." Das mag für Parteien und andere politische Organisationen gelten. Für mehr auch nicht. Patzelt selber vermittelt mit einem Überblick über den "Reformdruck" in Deutschland außerdem den Eindruck, daß es mit der Vertäuung in der westdeutschen Gesellschaft auch nicht zum besten steht. Allenthalben sieht er "Politikblockaden", die mit der deutschen Einheit erst richtig bloßgestellt worden seien. Sie bestünden "in der reduzierten Fähigkeit unseres politischen Systems, in akzeptabler Frist verbindliche Entscheidungen herbeizuführen und durchzusetzen".
In Patzelts Kritik am Status-quo-Denken, das in diesem Falle durchaus mit Besitzstandswahrung gleichzusetzen ist, schimmert der in Ostdeutschland verbreitete Unwillen darüber mit, daß der Wende im Osten im Westen nicht einmal der Hauch einer Umorientierung gefolgt sei. Vielmehr wurde die Entwicklung im Osten von einer selbstgefälligen Bestandsaufnahme der "Kosten der Einheit" (unentwegt beschworen von Lafontaine) begleitet. Nicht sie aber, sondern andere Kosten verlangen nach neuen Rezepten: etwa die des Sozialstaats, der Industriepolitik, der Einwanderung, des Steuerrechts. Mit Patzelt kann man deshalb sagen, daß fünf Jahre nach dem europäischen Umbruch und der Wende in der DDR allenfalls über die Notwendigkeit solcher Reformen Einigkeit besteht, "keineswegs aber schon über ihre Inhalte".
Nicht nur deshalb zeigt sich der Osten Deutschlands gegenüber dem Westen schon als "moderner". Indem man hier radikal umlernen mußte, setzt man Leistungshorizonte für die Zukunft auch des Westens. Zur Bilanz der Einheit gehören deshalb Sätze wie dieser: "Die Bewohner der bisherigen Bundesrepublik müssen mittelfristig nicht nur Wohlstandsverluste akzeptieren, sondern sich neuen Leistungsanforderungen gewachsen zeigen, ohne hierauf vorbereitet zu sein." Friedrich Fürstenberg ist deshalb in seiner Zusammenfassung der wirtschaftlichen Wende keineswegs der Meinung, daß die alte Bundesrepublik und ihre Form der Sozialen Marktwirtschaft Maßstab aller Dinge sei. "Das erforderliche ,Modernisierungsniveau' läßt sich also gerade im Wirtschaftsbereich nicht aus der Geschichte der bisherigen Bundesrepublik bestimmen." Zwar bleibt der Osten auf lange Sicht an die Unterstützung aus dem Westen angewiesen. Nicht aber als einseitiger Prozeß ist dieser Transfer zu verstehen, sondern jetzt schon als Wechselspiel gegenseitigen Ansporns.
Die "Angleichung" und "Vereinheitlichung" verläuft also nicht nur nicht einseitig. Sie hat sich, weil unverbindlich, als Kategorie einer deutsch-deutschen Standortbestimmung mittlerweile als unbrauchbar erwiesen. Das gilt zudem dort, wo es um das Leben selbst geht. Wir kehren also zur "kulturellen Integration" zurück, die in dem Buch anhand des Bildungssystems, des Familienlebens und der Jugendkultur eingehender untersucht wird. In allen drei Bereichen geht die "ehemalige DDR" einen Weg, der weniger von "Verwestlichung" gezeichnet ist als vielmehr von - drohender oder tatsächlicher - Arbeitslosigkeit. Dabei sind traditionelle Werte - etwa die Anhänglichkeit der Jugendlichen an ihr Elternhaus, die Wertschätzung der Familie, die Konzentration sowohl der Männer wie auch der Frauen auf ihren Beruf - ebenso ein Zeichen von Kontinuität wie ein Mittel zur Orientierung, was nicht als "Defizit", "Rückstand" oder gar als Ausfluß einer über Generationen weitergereichten deutschen "Untertanenkultur" herabgewürdigt werden sollte. Als Mangel könnten solche Eigenständigkeiten doch nur begriffen werden, wenn sie der Wende im Weg gestanden wären. Sie waren aber Stützen des Umbruchs.
Als großer wunderbarer Integrator taucht in dieser Einheits-Bilanz indessen immer wieder der Wohlstand auf. Er ist es letztlich, der in Deutschland etwas wirklich "vereinheitlicht" und im selben Augenblick zwischen Ost und West doch eine neue Kluft geöffnet hat, die Kluft der "sozialen Ungleichheit", wie sie Heiner Geißler beschreibt. Auch sie entsteht oft in erheblichem Maße nur in der Wahrnehmung: "Aus der östlichen Ferne glänzt der Westen goldener als aus der erfahrenen Nähe. Auf der anderen Seite unterschätzen die Ostdeutschen das Niveau der Lebensbedingungen in den neuen Ländern; die Mangellage kommt ihnen drastischer vor, als diese de facto ist." Es ist wohl der schönste Erfolg der deutschen Einheit, daß nicht nur der Osten Schwierigkeiten hat, sich selber wiederzuerkennen. JASPER VON ALTENBOCKUM
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


