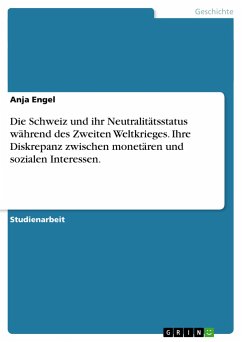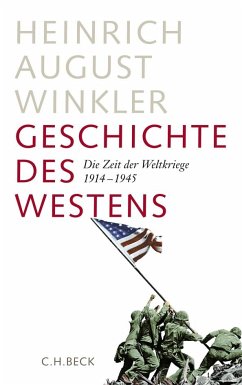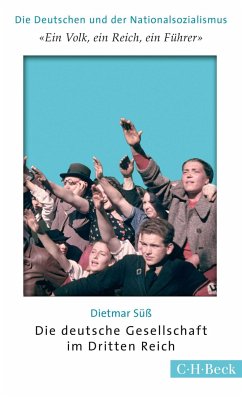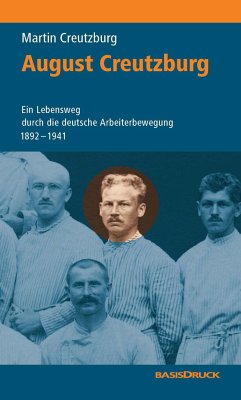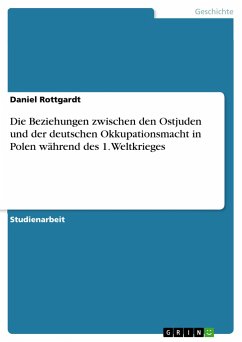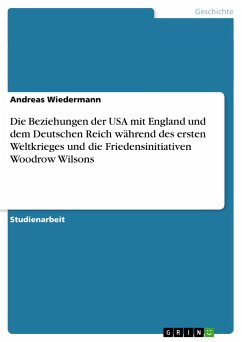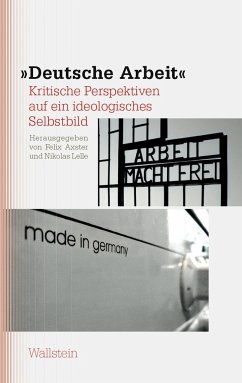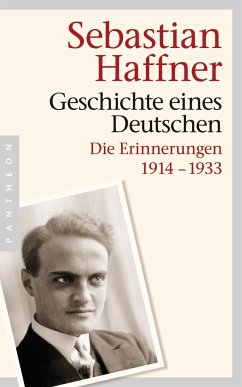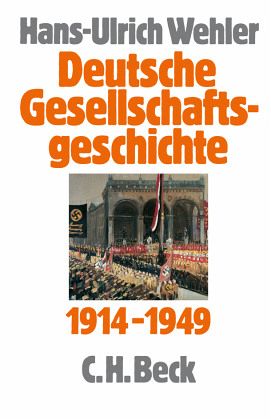
Deutsche Gesellschaftsgeschichte Bd. 4: Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949 / Deutsche Gesellschaftsgeschichte Bd.4
Ausgezeichnet mit dem Preis Das Historische Buch, Kategorie Neueste Geschichte 2003
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
49,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Hans-Ulrich Wehlers Deutsche Gesellschaftsgeschichte behandelt in diesem Band die Epoche des "zweiten Dreißigjährigen Krieges" seit 1914. Die ersten vier Nachkriegsjahre, die ganz von den Kriegsfolgen überschattet waren, werden dabei in die Darstellung einbezogen. Wiederum analysiert der Autor die wichtigsten Dimensionen der Gesellschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Eines der großen Geschichtswerke der Nachkriegszeit nähert sich damit seinem Abschluß. Ein fünfter Band, der die Geschichte der beiden deutschen Staaten und die Vereinigung darstellt, wird folgen.Der vierte Band der...
Hans-Ulrich Wehlers Deutsche Gesellschaftsgeschichte behandelt in diesem Band die Epoche des "zweiten Dreißigjährigen Krieges" seit 1914. Die ersten vier Nachkriegsjahre, die ganz von den Kriegsfolgen überschattet waren, werden dabei in die Darstellung einbezogen. Wiederum analysiert der Autor die wichtigsten Dimensionen der Gesellschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Eines der großen Geschichtswerke der Nachkriegszeit nähert sich damit seinem Abschluß. Ein fünfter Band, der die Geschichte der beiden deutschen Staaten und die Vereinigung darstellt, wird folgen.
Der vierte Band der großen Deutschen Gesellschaftsgeschichte behandelt die Epoche von 1914 bis 1949, umspannt also die beiden Weltkriege, die Zerstörung der Weimarer Republik, die Führerdiktatur Hitlers, den Holocaust und die Nachkriegsjahre bis zur Gründung der beiden deutschen Neustaaten. Erneut werden Wirtschaft und Sozialstruktur, politische Herrschaft und Kultur als die dominierenden Dimensionen der deutschen Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung analysiert.
Der erste Abschnitt stellt neben der militärischen Entwicklung die sozialökonomischen und ideenpolitischen Konstellationen während des Ersten Weltkriegs dar. Insbesondere geht es um die Spannungen im politischen System und in der deutschen Klassengesellschaft bis hin zur Revolution von 1918.
Der zweite Abschnitt verfolgt die kurze Geschichte der ersten deutschen Republik, der trotz ihrer hohen Anfangsbelastungen die Konsolidierung zu gelingen schien. Doch unter dem zerstörerischen Anprall der Weltwirtschaftskrise seit 1929, dem Druck der beiden radikalen Flügelparteien, NSDAP und KPD, und der auf eine autoritäre Lösung drängenden Machteliten zerfiel nicht nur das politische Institutionengefüge, sondern auch die Konsensbasis der Republik. Im Mittelpunkt des dritten Abschnitts steht das "Dritte Reich". Im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und im Genozid an den europäischen Juden erreichte die Zerstörungsfähigkeit, die durch Hitlers charismatische Herrschaft in der deutschen Gesellschaft freigesetzt wurde, den Tiefpunkt eines "Zivilisationsbruchs". Allgemein zielt die Deutung der Führerdiktatur darauf, die nationalsozialistischen Jahre nicht als erratischen Block im historischen Prozeß zu verfremden, sie vielmehr im Zuge einer dezidierten Historisierung des Nationalsozialismus weithin in die Kontinuität der neueren deutschen Geschichte einzuordnen.
Der vierte Band der großen Deutschen Gesellschaftsgeschichte behandelt die Epoche von 1914 bis 1949, umspannt also die beiden Weltkriege, die Zerstörung der Weimarer Republik, die Führerdiktatur Hitlers, den Holocaust und die Nachkriegsjahre bis zur Gründung der beiden deutschen Neustaaten. Erneut werden Wirtschaft und Sozialstruktur, politische Herrschaft und Kultur als die dominierenden Dimensionen der deutschen Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung analysiert.
Der erste Abschnitt stellt neben der militärischen Entwicklung die sozialökonomischen und ideenpolitischen Konstellationen während des Ersten Weltkriegs dar. Insbesondere geht es um die Spannungen im politischen System und in der deutschen Klassengesellschaft bis hin zur Revolution von 1918.
Der zweite Abschnitt verfolgt die kurze Geschichte der ersten deutschen Republik, der trotz ihrer hohen Anfangsbelastungen die Konsolidierung zu gelingen schien. Doch unter dem zerstörerischen Anprall der Weltwirtschaftskrise seit 1929, dem Druck der beiden radikalen Flügelparteien, NSDAP und KPD, und der auf eine autoritäre Lösung drängenden Machteliten zerfiel nicht nur das politische Institutionengefüge, sondern auch die Konsensbasis der Republik. Im Mittelpunkt des dritten Abschnitts steht das "Dritte Reich". Im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und im Genozid an den europäischen Juden erreichte die Zerstörungsfähigkeit, die durch Hitlers charismatische Herrschaft in der deutschen Gesellschaft freigesetzt wurde, den Tiefpunkt eines "Zivilisationsbruchs". Allgemein zielt die Deutung der Führerdiktatur darauf, die nationalsozialistischen Jahre nicht als erratischen Block im historischen Prozeß zu verfremden, sie vielmehr im Zuge einer dezidierten Historisierung des Nationalsozialismus weithin in die Kontinuität der neueren deutschen Geschichte einzuordnen.