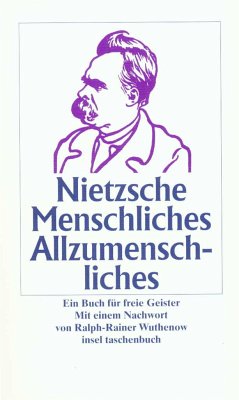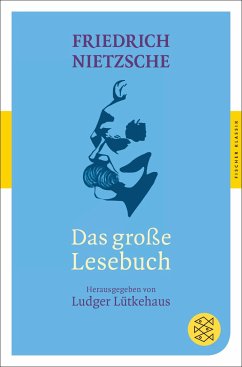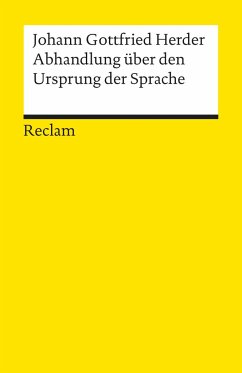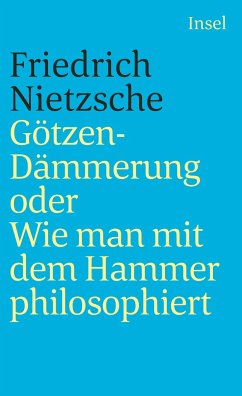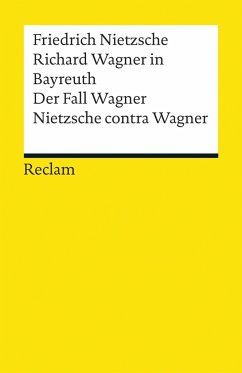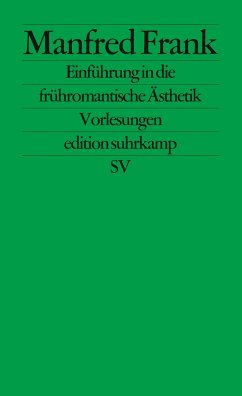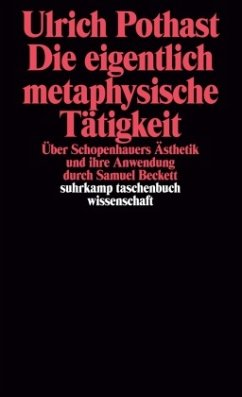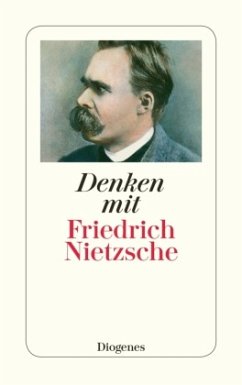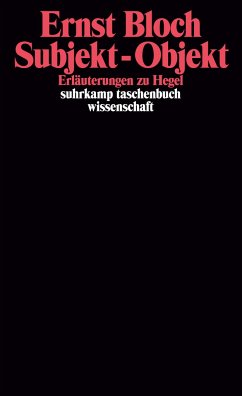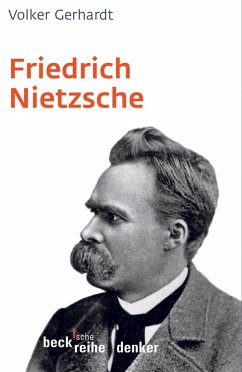Kritik sieht sowohl unsere Interpretation der Welt nach einem sprachlichen Schema, das wir nicht abwerfen können, wie den letztlich physiologischen Versuch, uns ihrer zu bemächtigen, dem Zufall geschichtlich veränderlicher Kräftekonstellationen ausgesetzt.
Zwei dieser drei Achsen, die Sprachkritik und die physiologische Kritik, hat Christof Kalbin in seiner Berliner Dissertation von 1997 unter dem Vorzeichen der "Selbstbildung" aufeinander bezogen. Überzeugend hat er den Übergang vom Frühwerk zum mittleren und Spätwerk als sprachtheoretische Transformation dargestellt, dabei aber den Einfluß der Sprach- und Erkenntniskritik von Lichtenberg auf Nietzsche übersehen: Während das Frühwerk im Anschluß an Arthur Schopenhauers Willensmetaphysik im Individuum noch die unmittelbare Selbstvergegenwärtigung suchte, unterwerfen sowohl die Sprachkritik wie die physiologische Kritik Nietzsches das Subjekt zwei seiner Kontrolle schmerzlich entzogenen Kräften: Es gebietet über seine Ausdrucksmöglichkeiten letztlich sowenig wie über die Kräfte seines Körpers.
Entlang dieser beiden Achsen rekonstruiert Kalb anthropologisch Nietzsches Menschenbild als Bild von der Form- und Interpretierbarkeit, ja Interpretationsbedürftigkeit der menschlichen Natur. Das "nackte Leben" bedarf, wie der italienische Philosoph Giorgio Agamben im Anschluß an Michel Foucaults Reflexion der "Bio-Politik" sagt, der institutionellen Einkleidung, oder es ist ebenso vogelfrei wie verloren. Nietzsche hat denselben Sachverhalt in "Jenseits von Gut und Böse" unvergleichlich viel aggressiver und verletzender formuliert: "der Mensch" ist "das noch nicht festgestellte Thier". Erst das konstruktive Moment der "Selbstbildung" im Medium der Kunst weckte in Nietzsche vorübergehend die Illusion, den durch seine drei kritischen Achsen gesprengten Raum wieder schließen zu können. Kalb sitzt dieser Illusion auf, die für Nietzsche nur die entlastende Funktion der Schärfung seiner erkenntniskritischen Vorbehalte hatte, und läßt sein Buch in ein allzu versöhnliches Kapitel münden.
Die Dissertation ist bis zur Veröffentlichung drei für die Nietzsche-Forschung fruchtbare Jahre lang liegengeblieben, ohne daß der Autor - bis auf die Monographie von Reinhard Gasser über "Nietzsche und Freud" (siehe F.A.Z. vom 21. April 1998) - wenigstens die seine Argumentation unmittelbar berührenden Monographien nachgetragen hätte. So vermißt man Hans Gerald Hödls Panorama zu Nietzsches früher Sprachkritik (siehe F.A.Z. vom 30. Oktober 1997), das gleichzeitig mit Kalbs Dissertation eine Reihe von Forschungsergebnissen zusammenfaßt, die in dieser nur zum Teil berücksichtigt sind; und Marco Brusottis nahezu erschöpfende Berliner Dissertation über Nietzsches philosophische Selbstgestaltung (siehe F.A.Z. vom 28. August 1997) hätte Kalb sowohl auf die Quellen von Nietzsches physiologischer Radikalisierung seiner Willenskritik wie seiner ästhetischen Selbststilisierung nach dem Vorbild der antiken Kyniker aufmerksam machen können.
So zeugt dieses Buch, das zwei Gesichter Nietzsches aufs anregendste erhellt und dabei für einen Augenblick hoffen durfte, dem "gängigen Nietzsche-Bild" einen Schritt voraus zu sein, gerade dort, wo es sich mittlerweile überholt sieht, von der Wirkungsmächtigkeit der dritten Achse in Nietzsches Denken, die es vernachlässigt: der historischen Kritik. Auch die Selbstbildung als leiblich-sprachlicher Prozeß ist nur eines unter vielen Experimenten, der Geschichte zu trotzen, nicht ihr Ziel. Christof Kalbs "Desintegration" gehört zu den seltenen Büchern, in denen dieses Problem als nicht abgegoltenes wenigstens aufgeworfen wird.
MARTIN STINGELIN.
Christof Kalb: "Desintegration". Studien zu Friedrich Nietzsches Leib- und Sprachphilosophie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 320 S., br., 24,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.02.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.02.2001