Menschenbilder und Herrschaftsmodelle und können aus den Erfahrungen lernen."
Brechtken, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, hat vor drei Jahren eine umfangreiche Biographie Albert Speers veröffentlicht, die für ihre gründliche Quellenarbeit gerühmt wurde und ihren Autor einem breiteren Publikum bekannt machte. Diesmal hat er sich etwas ganz anderes vorgenommen. "Der Wert der Geschichte" ist ein politisches Buch: Der Wert, den der Autor der Geschichte zuspricht, soll sich in der praktischen Bewältigung der Gegenwart zeigen, als Förderung einer demokratischen, emanzipatorischen, sozialen, friedensgeneigten Politik. Die Erkenntnisfortschritte in der, wie er sich ausdrückt, "harten Welt" der Natur- und Ingenieurwissenschaften liegen für alle offen zutage, da scheint ihm "merkwürdig", dass man "in der weichen Welt" der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder in altertümliche Handlungsweisen zurückfalle, wo uns doch aus der Geschichte "ein riesiger Fundus an Erfahrung und Wissen" zur Verfügung stehe.
Wer sich auch nur kurz einmal mit Wissenschaftstheorie befasst hat, wird das weniger merkwürdig finden. Mit der traditionellen Unterscheidung von nomothetischen Naturwissenschaften und idiographischen Geistes- oder Humanwissenschaften kommt man schon weiter. Die Naturwissenschaften neigen zur Gesetzbildung; ein Kriterium gelungener experimenteller Arbeit ist die Wiederholbarkeit des Experiments. Die Geisteswissenschaften dagegen beschreiben Individualitäten, eine Epoche etwa, einen Stil, ein Werk, eine gesellschaftliche Formation. Dabei hat Brechtken den fundamentalen Unterschied zwischendurch am Wickel, wenn er gegen den Glauben an eine vorbestimmt ablaufende Geschichte polemisiert, also den Unwägbarkeiten, der inneren Heterogenität der historischen Welt ihre Rolle zuweist. Aber er ist intellektuell so fahrig, dass ihm gar nicht auffällt, was das für seine Vorstellung vom Lernen aus der Geschichte bedeutet: Aus einem Gegenstand, der seiner Natur nach diskontinuierlich ist, lässt sich nicht so leicht etwas lernen. Und dass uns heute die historische Erfahrung ein sicherer Schutz vor politischer Verirrung ist, wer sollte das glauben? Auch 1930 gab es schon eine ernsthafte Geschichtswissenschaft, hierzulande nicht weniger als in den Nachbarländern, und doch haben Historiker das Verhängnis des Nationalsozialismus nicht klarer erkannt als andere Deutsche.
Brechtkens Buch setzt sich ein für die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Überwindung des Nationalismus, den Frieden und den sozialen Ausgleich bei Wahrung der marktwirtschaftlichen Ordnung. Das alles ist nicht unsympathisch, aber was hat das mit dem "Wert der Geschichte" zu schaffen? Der Autor beschreibt die Kämpfe für die genannten Ideale, für das Frauenwahlrecht etwa, und die furchtbaren Folgen von Nationalismus und Krieg. Das Dumme dabei ist aber, dass der Kampf des Westens für Fortschritt und Aufklärung bei Brechtken, dem scharfen Religionskritiker (Religion sieht er als großen Treiber des Fanatismus, ein Vorwurf, den er auch dem Marxismus und natürlich dem Nationalsozialismus macht), etwas Predigthaftes, ja Pfäffisches bekommt. Das Bewusstsein, an der Spitze des moralischen Fortschritts zu stehen, ist intellektuell und moralisch nicht sehr attraktiv, es hat etwas Selbstzufriedenes.
Brechtken sieht schon, dass der Erfolg der chinesischen Volkswirtschaft für Europa eine Herausforderung bedeutet. Wir haben geglaubt, wirtschaftlicher Erfolg sei nicht möglich ohne Freiheit der Marktteilnehmer, die einhergehe mit Demokratie und politischer Freiheit. Nun könnte es so sein, dass uns China eines anderen belehrt. Aber nein, Brechtken fordert für Europa umstandslos die Fortsetzung des bewährten Weges mit Stärkung des sozialen Ausgleichs, so werde die hiesige ökonomische Dynamik gesichert. Was möglicherweise in China neu ist, ob das Land vielleicht über Kraftquellen verfügt, die jenseits unserer Wertvorstellungen liegen, das wird nicht einmal angetippt.
Ein anderes Beispiel seiner gusseisernen Selbstsicherheit: Im Kapitel über die politisch schädlichen Folgen der Religion kommt der Autor kurz auf Ernst-Wolfgang Böckenfördes berühmtes Diktum zu sprechen, dass der freiheitliche säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebe, die er selbst nicht garantieren kann. Dahinter liegt die Annahme, dass der Staat eines Gemeinsinns bedarf, dessen Entstehung durch eine gewisse Homogenität erleichtert wird; aus ganz anderer Richtung hat der britische Historiker Tony Judt ähnlich geurteilt: Der Sozialstaat brauche eine "funktionierende Vertrauensgemeinschaft", eine Gesellschaft mit Vertrauen aber sei "tendenziell kompakt und recht homogen".
Judt war Jude, Belehrungen über die dunklen Seiten homogener Gesellschaften brauchte er sicherlich nicht. Aber Brechtken fertigt solche Gedanken einfach ab: Es bedürfe nicht der Homogenität, "sondern der Humanität aus rationaler Freiheit". Doch genau das ist ja die Frage, die hier nicht beantwortet, sondern abgewürgt wird. Dass Humanität aus "rationaler Freiheit" sprudele, dass Rationalität zugleich Humanität und Moral bedeute - warum sollte das so sein? Rationalität kann mit blanker Amoralität einhergehen.
Was "rationale Freiheit" ist, erfährt man auch nicht genau; so wenig wie man versteht, ob zwischen "Rationalität, Aufklärung und Vernunft als Prinzipien des Fortschritts" zu differenzieren ist, oder die Worte "Rationalität, Aufklärung und Vernunft" hier alle das Gleiche meinen. Die Naivität, mit der Brechtken das Wort (von "Begriff" mag man kaum sprechen) "Rationaliät" verwendet, ist erstaunlich. Er habe kein "Fachbuch der Geschichtswissenschaft" geschrieben, sagt der Autor, er habe eine "barrierefreie Zusammenfassung" geben wollen. Aber er hat verkannt, dass ein Buch für Fachfremde zu schreiben auch Mühe machen sollte, nicht weniger Mühe als eines für die Kollegen.
STEPHAN SPEICHER
Magnus Brechtken:
"Der Wert der Geschichte". Zehn Lektionen für die
Gegenwart.
Siedler Verlag, München 2020. 303 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
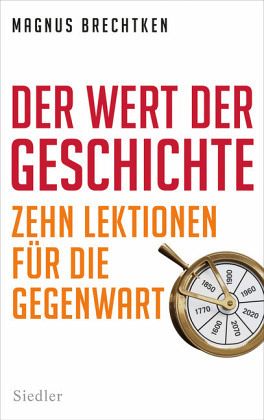





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2020