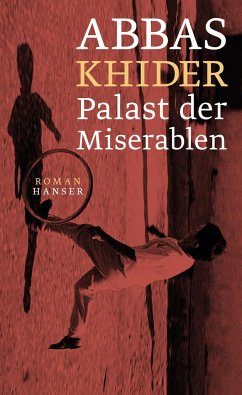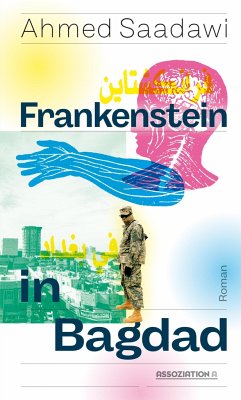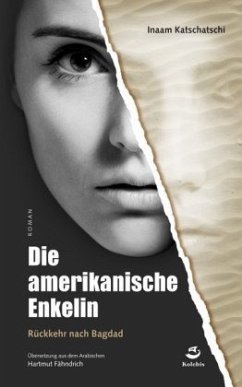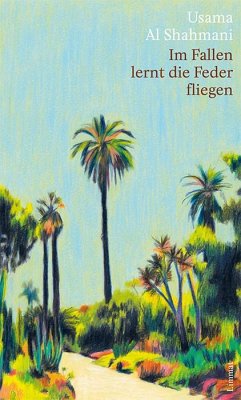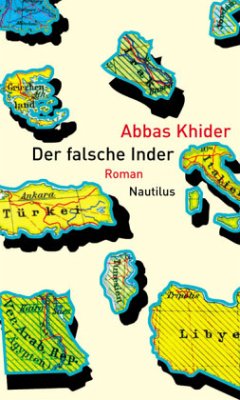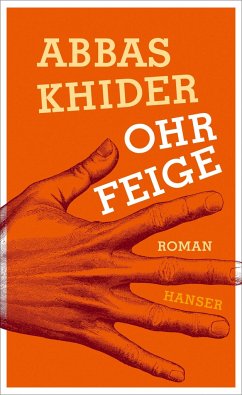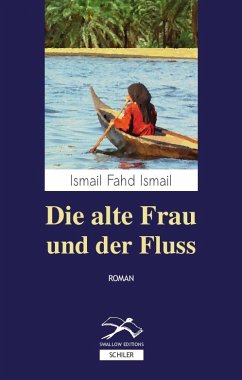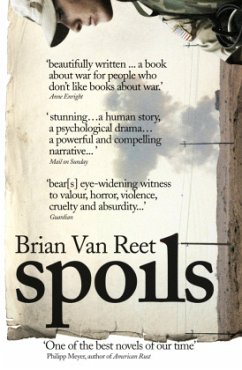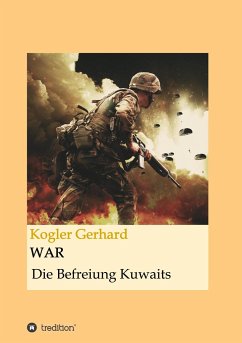sich die literarisch geniale Einsendung eines gefallenen Soldaten aneignet. Er wird berühmt, doch die Einsendungen reißen nicht ab, und vor lauter Angst aufzufliegen wird er wahnsinnig und verbrennt die zu einer Bibliothek angewachsene Sammlung der eingesandten Meisterwerke mitsamt der Leiche des Soldaten. "Warum haben Sie einen Brennofen für Romanmenschen?", lautet der plakative letzte Satz dieser aus sprödem Holz geschnitzten Story.
Wir begreifen die Botschaft: Die wahre Kunst ist unter Regimen wie dem Saddams chancenlos, die Parteibonzen eignen sich alles an und zerstören es zugleich. Interessant wird die Geschichte erst, wenn man sie als Symptom liest: Sie tritt dann gleichsam selbst den Beweis an, dass die irakische Literatur an der Realität zerbricht oder ihr allein durch unerhörte Übersteigerungen gerecht wird. Nur dass eben Hassan Blasim nicht die irakische Literatur ist. Wer wissen will, wie man die irakischen Erfahrungen auch anders erzählen kann, lese Abbas Khidr, Najm Wali oder Fadhil Al-Azzawi, um nur die großen irakischen Autoren zu nennen, die in Deutschland leben.
In Hassan Blasims vierundzwanzig, gelegentlich aufeinander anspielenden Kurzgeschichten wimmelt es von Schriftstellern. Manchmal heißen sie auch Hassan Blasim, und unglücklich sind sie immer, wie etwa Chalid Hamrani, der, als säße er in E. T. A. Hoffmanns "Des Vetters Eckfenster", kein anderes Thema kennt als den Markt neben seiner Wohnung. Man wüsste gern, was er darüber schreibt, aber für Blasim ist das Motiv vor allem eine Gelegenheit, seine Literatur gegen "nicht enden wollende Aufforderungen, verständlich zu schreiben, realistisch, dokumentarisch, pragmatisch", zu verteidigen.
Tatsächlich hat sich Blasim vom Realismus verabschiedet, aber das haben schon viele arabische Autoren vor ihm getan. Noch keiner von ihnen ist jedoch auf die Idee verfallen, eine an Quentin Tarantinos Filmen geschulte Pulp-Fiction-Ästhetik zur Darstellung der irakischen Realität zu nutzen. Die Idee scheint gut, denn surreal und gespenstig geht es im Irak ganz gewiss zu. Aber wenn schon Tarantino, denken wir, dann bitte richtig!
Blasim berichtet vom Geschlechtsteil einer Selbstmordattentäterin, welches die Frau des Fischverkäufers auf dem Markt unter den Fischen findet, und was daraus folgt, wird von Hartmut Fähndrich angemessen drastisch übersetzt. Doch statt diesen obszönen und natürlich auch geschmacklosen Humor in bester Tarantino-Manier stehenzulassen, fügt Blasim wie ein moralisierender Erzähler des neunzehnten Jahrhunderts mit erhobenem Zeigefinger hinzu: "Diese Art Geschwafel ist das Resultat einer langen Geschichte von Gewalt, Unterdrückung und Zerstörung ... Es ist primitives, tribales Gesabber, das sich hinter geschmacklosem, irrwitzigem Gelächter versteckt." In Wahrheit aber funktioniert dieser Witz nicht anders als die von makabren, sexualisierten und geschmacklosen Vorkommnissen wimmelnden Erzählungen von Hassan Blasim selbst.
Neben diesen moralinsauren Splatterstories aus dem Irak stehen Migrationsgeschichten, die exakt derselben zerknirschten Erzähllogik folgen. "Ich bin überzeugt, dass das Schreiben sich nicht behindern lassen darf durch das demütige Gefühl Massen von Menschen gegenüber, aus deren Hemden der Schweiß dampft und die sich ähneln wie die Klos einer Toilette." Der Vergleich von Menschen mit Toiletten spricht Bände. Aber direkt danach berichtet Blasim von "der Poesie des menschlichen Gesichts, das wie ein Juwel unter Millionen Tonnen von Trivialmüll verborgen ist". Dieses "Juwel" ist für ihn die Geschichte von Ali Basrawi, der vor der Flucht aus dem Irak die Gebeine der von der Familie zu Tode geschundenen Mutter ausgräbt und in einer Tasche mit ins Exil nimmt. Nur der Kopf, "der sich einst zärtlich über ihn geneigt hatte", geht auf der Reise verloren.
Solche Vorliebe fürs morbide Detail, gepaart mit Gefühlskitsch und einer seltsamen Verächtlichkeit. prägt auch die anderen Geschichten aus dem Flüchtlingsdasein. Dabei kann es durchaus zu Momenten der Wahrheit kommen, etwa wenn ein sich im holländischen Exil Carlos Fuentes nennender Iraker holländischer wird als alle Holländer und seine Herkunft und Landsleute verabscheut, wie es wohl manchen Exilanten passiert. Bis er eines Tages von seinen Albträumen eingeholt wird und sich im Namen seines verdrängten irakischen Ichs aus dem Fenster stürzt. Auch diese Erzählung ist durchwachsen von Verachtung und Spott für ihre Figur, so dass man am Ende sogar Mitleid mit Carlos Fuentes bekommt, einfach weil seine Geschichte von diesem Hassan Blasim erzählt wird. Wer besonders schlau sein will, möchte diesen Effekt als höhere erzählerische Absicht deuten. Wir halten das eher für einen Unfall und wundern uns, warum die britischen Kritiker unter allen arabischen Autoren ausgerechnet den trivialsten gekrönt haben. Könnte es sein, dass er ihrem überkommenen, von "Tausendundeiner Nacht" geprägten Bild arabischer Literatur schlicht am ehesten entsprochen hat?
STEFAN WEIDNER
Hassan Blasim: "Der Verrückte vom Freiheitsplatz und andere Geschichten über den Irak".
Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich. Verlag Antje Kunstmann, München 2015. 256 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
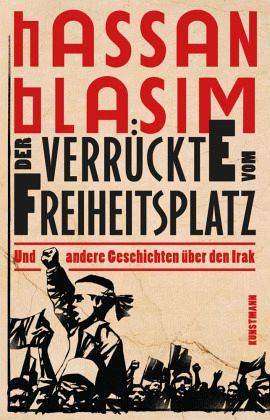




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.08.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.08.2015