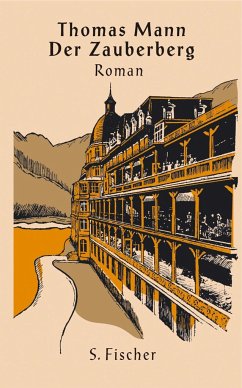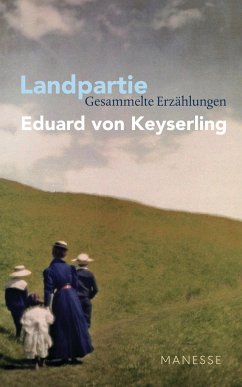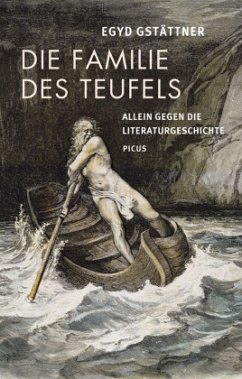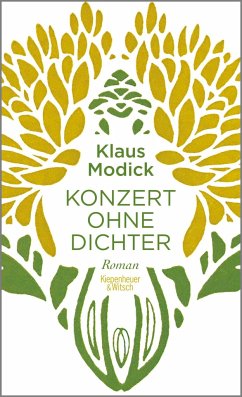Sippe vorführte, in welcher Thomas, anders als vermutlich intendiert, als der einzig Normale erschien.
Allein aus diesem Grund muß man für eine Familienaufarbeitung dankbar sein, die auf dem Terrain operiert, auf dem sich Erkenntnisse über Literaten und deren Anhang vielleicht doch am ehesten mitteilen lassen: dem der Literatur - womit freilich schon vorausgesetzt ist, daß es Thorsten Becker überhaupt um Erkenntnis und nicht bloß um Unterhaltung zu tun ist. Sein Roman "Der Untertan steigt auf den Zauberberg" lohnt die Lektüre in beiderlei Hinsicht. Man darf sich von dem stilistischen Mischmasch, der gerade am Anfang irritierend wirkt, allerdings nicht abschrecken lassen - allzu bunt wirkt die Maskerade, deren sich der Erzähler Ulf Blüthenreich bedient, um Zeit- und Familiengeschichte miteinander, und dies auf mehreren Ebenen, zu verbinden. Letzteres hat er mit Breloers Film gemeinsam.
Was er ihm voraushat, ist die innere Perspektive, die uns einen Thomas Mann ausleuchtet, dessen größte und auch von der Forschung nie bestrittene Schuld der "Seelenraub" ist: Daß er die Leute, die um ihn herum waren, regelrecht und keineswegs immer zu deren Vorteil ausgebeutet hat, war der Vorwurf, mit dem Thomas Mann von Anfang an zu kämpfen hatte und dem er nur ästhetisch, nicht aber moralisch zu begegnen wußte. Es ist ja auch etwas dabei herausgekommen, will uns Beckers Erzähler sagen, und das allein hebt sich wohltuend ab von dem lange gebräuchlichen Klischee kalter Ausbeutung.
Ulf Blüthenreich ist ein Psychiater auf dem flachen norddeutschen Land, der es mit einer Patientin zu tun bekommt, die sich für Erika Mann hält und deren exaltiertes Benehmen dafür einen so triftigen Anhaltspunkt bietet wie die intime Kenntnis der inneren wie äußeren Angelegenheiten der Familie Mann. Die Therapiegespräche handeln natürlich von den Mannschen Spezialthemen Genie-Wahnsinn, Künstler-Gesellschaft, Produktivität-Einsamkeit und nehmen derart buntscheckige Form an, daß man bald nicht mehr weiß, wer wer ist.
Das Spiel mit den Identitäten ist aber genauso beabsichtigt wie leider wohl auch der etwas zu ambitionierte dramaturgische Kniff, der Mannschen Seelengeschichte noch einen veritablen Entwicklungsroman beizuordnen, der am nämlichen Ort spielt, in Orbeswenden, in dem man Worpswede so leicht erkennt wie dessen leicht wiedererkennbar verschlüsseltes Personal. Wozu das gut sein soll, ergibt sich bis zum Ende nicht. Daß Thomas Mann mit der dort ansässigen Künstlerkolonie fast noch weniger am Hut hatte als mit Rilke, ist noch kein Argument und wäre ohne weiteres hinzunehmen in diesem Roman. Aber der zweite Handlungsstrang läßt die ganze Komposition doch etwas unelegant erscheinen, so daß sich Becker hier wohl übernommen hat.
Womit er sich - und das ist das eigentlich Bemerkenswerte an diesem Werk - nicht übernommen hat, das ist der Mann-Komplex. Halten wir uns also an ihn.
Es kann kein Zweifel sein, daß die Thomas-Mann-Philologie, gegen die Becker manchen Hieb austeilt, im Laufe des vergangenen Jahrhunderts viel Wissenswertes und Aufschlußreiches zutage gefördert hat; Leben und Werk dieses Autors wären uns ohne diese Anstrengungen bei weitem nicht so nahe. Aber Becker stellt diese Nähe auch her. Er tut dies mit einer Unbefangenheit, welche sich die wissenschaftliche Forschung aus guten Gründen versagt. In der Kunst aber ist sie erlaubt. Und so haben wir denn so ziemlich die Entsprechung dessen vor uns, was Thomas Mann selbst einst am Beispiel Goethe auf sich nahm: die Annäherung an ein künstlerisches Genie, dessen charakterliche Defizite auch ohne den Preis einer Demontage bloßgelegt werden.
"Lotte in Weimar" heißt dieser wichtige Roman von 1938, den Becker als geistige Referenz ständig präsent hält und den er als autobiographisches Schlüsselwerk Thomas Manns ausreichend kenntlich zu machen weiß. Mit diesem Vergleich ist Beckers Buch natürlich zu hoch gestellt; stilistisch und geistig kann er mit der "Lotte" nicht mithalten. Aber es geht um das geistige Aneignungsverfahren, das Becker so dreist handhabt, daß er damit direkt zum produktiven Kern des Mannschen Problems vordringen kann: Wie kann sich geistige Größe auch menschlich achtbar halten? Beziehungsweise: Ist sie daran überhaupt interessiert?
Die Antwort fällt so zwiespältig aus, wie Thomas Mann selbst sie gab: Anders geht es eben nicht, als daß ein Schriftsteller, der Bedeutendes im Schilde führt, dafür einen Preis zahlt - und auch andere zahlen läßt. Dazu erfahren wir aus dem Munde des fingierten Eri-Kindes Aufschlußreiches über die sehr heiklen Entstehungsbedingungen der "Betrachtungen eines Unpolitischen" und des "Zauberbergs", die alles andere als "Beiträge zur Wissenschaft vom Nichtwissenswerten" sind - mit Erbsenzählereien hält sich Becker nicht auf. Wenig plausibel ist allerdings, daß Heinrich durch den "Zauberberg" eine tiefe Kränkung erfahren haben soll, wie der Erzähler es nahelegt - die Settembrini-Figur wird im Laufe des Romans ja immer sympathischer und böte im Gegenteil eher Anlaß für Heinrich, sich durch dieses Porträt geschmeichelt zu fühlen.
Der Bruder-Komplex, dessen enorme Bedeutung Becker keineswegs verkennt, führt gleichzeitig auf die Schwäche, die der ganzen Romankonstruktion zugrunde liegt: Die "Untertan"-Welt ist mit der des "Zauberbergs" geistig auf keinen Nenner zu bringen. Heinrich, so sah es Thomas Mann bis zuletzt, machte Tendenzkunst. Der Jüngere dagegen wollte alles in der Schwebe lassen. Die Kluft zwischen den beiden war tiefer, als es in dem geisterhaften Reigen, den Becker uns vorführt, den Anschein hat.
EDO REENTS
Thorsten Becker: "Der Untertan steigt auf den Zauberberg". Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2001. 335 S., geb., 19,90
.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main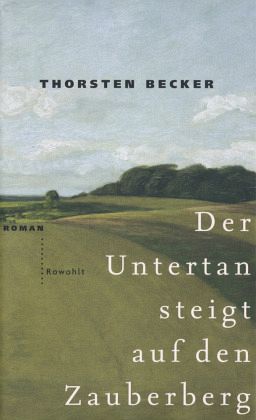




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.02.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.02.2002