ausgezehrt und abgemagert und hungert außer nach der Schweineleber fast noch mehr nach Weltanschauungskost sowie moderner Dichtkunst. So schreibt man Gedichte, gründet Zeitschriften, verschlingt "The Black Mountain Review" und übersetzt. Zur gemeinschaftlichen Lesung von "The Waste Land" versammeln sich die Lyrik-Liebhaber in Scharen, auf dem Boden hockend und die Kriechkälte mit abgewetzten Wintermänteln abwehrend. Und nach seiner Philosophievorlesung lädt der Professor noch zu sich nach Hause, um das Gespräch angeregt fortzusetzen. Wir befinden uns Mitte der fünfziger Jahre in Heidelberg, einer deutschen Universitätsstadt der Nachkriegszeit.
Dort herrscht eine Atmosphäre aus Wirtschaftswunderseligkeit und Alltagsmisere, intellektueller Aufbruchsstimmung und provinzieller Nabelschau, nachholender Hoffnung auf Weltverbindungen und ernüchternder Erfahrung unveränderter Begrenztheit. Vermittelt wird uns dieses eigentümliche Milieu in einem Erzählkaleidoskop aus kurzen Passagen, teilweise satirisch zugespitzt, teilweise pathetisch aufgeladen, einige in Brief- oder Berichtsform, andere aus überhöhter Perspektive dargeboten - eine dichte Folge prägnanter Skizzen, zuweilen nur einen knappen Absatz lang, zuweilen ein paar Seiten, durchsetzt von reinen Dialogpassagen sowie fiebrigen Traumprotokollen und mit wunderlichen Zwischenüberschriften versehen, wie "Speläologie", "Kamakura" oder "Die unüberschreitbaren Grenzen des menschlichen Körpers sind einfach nur schrecklich". Alles reichlich rätselvoll. Und doch entsteht bei der Lektüre solch ein Sog, dass man diesen Roman, sofern man überhaupt so weit gekommen ist, ab jetzt kaum mehr aus der Hand legt.
Es handelt sich bei "Der Sonnenwächter" um die späte Wieder- oder, genauer gesagt, Neuentdeckung eines amerikanischen Debütromans, der 1963 zuerst in London erschien, ein Jahr später in New York und seinerzeit ein wohlwollendes, zum Teil euphorisches Kritikerecho auslöste, bei uns jedoch ganz unbeachtet blieb. Er erzählt das bewegte Leben eines Waisenkinds der Weltgeschichte, Jahrgang 1929, Sohn eines Zigeuners und einer Berlinerin, der, von den Nazis deportiert, Auschwitz überlebt, nach dem Krieg von einem amerikanischen Wohltäter erst adoptiert und dann missbraucht wird, anschließend nach Paris und Heidelberg gelangt, sich dort in Affären verstrickt und die Selbstsuche fortsetzt. Sein Autor, Charles Haldeman (1931 bis 1983), war Sohn eines deutschen Vaters und verbrachte nach dem Weltkrieg einige Semester in Heidelberg, bevor er sich 1957 in Griechenland niederließ. Dort fand er, neben einer Anstellung als Lehrer, bald zum Schreiben und verfasste drei Romane sowie ein paar Drehbücher. Nachdem sein Debüt schon in den sechziger Jahren in etliche europäische Sprachen übersetzt wurde, lädt jetzt der Metrolit Verlag zur späten deutschen Erstlektüre ein.
Der Eindruck reicht von Faszination bis Entnervtheit. Fesselnd ist der zweite Teil, der eine Collage deutscher Nachkriegswirklichkeit entwirft und einen bizarren Reigen an Figuren aufbietet: Kriegsheimkehrer, Schicksalsversehrte, Lagertraumatisierte, Korpsstudenten, Austauschstudenten, Amerikaner, Fräuleins mit grünlackierten Fingernägeln, Funktionsträger mit Entnazifizierungsschein, Studienräte, die dem Alkohol verfallen, Zimmerwirtinnen, die morgens Muckefuck servieren - alle so knapp wie scharf gezeichnet. Der erste Teil dagegen enthält Aufzeichnungen, in denen die Hauptfigur ihr früheres jahrelanges Wanderleben - als Zigeunerkind, Halbarier, Lagerinsasse, Flüchtling, Adoptivsohn, Liebhaber, Lyriker und ständiger Selbstsucher - in tagebuchartigen Einträgen festhält.
Das ist oftmals leider schwer erträglich. Denn statt der Fokussierung auf einen zentralen Ort, der in sein soziales Spektrum aufgefächert wird, bietet diese erste Hälfte ein heftiges Schauplatz- und Geschichtengewimmel, episodisch ausgebreitet, aber zahnlos, und statt pointierter Prosa eine faule Mischung aus expressionistisch aufgeladenen Passagen ("Auf den Zehenspitzen ihrer knochenschwachen Erinnerung ist sie in identischen Garnrollen verloren, der fünfte abgespulte Schwan der zweiten Reihe"), pubertärer Gefühligkeit ("Monatelang existierten unsere Körper nur als ambulante Hohlräume voller Echos und vernehmbar pulsierendem Blut, als die Streckbänke kurzer Tage, auf denen sie zerbrachen"), sentenziösem Geschwurbel ("die Freiheit eines Kindes ist etwas anderes: selbstverständlich, zerbrechlich, ausgeübt und nicht innerlich wahrgenommen"), KZ-Kitsch ("ein intaktes Refugium, ein Modell des Universums"), vielen Stilblüten und angestrengter Selbstreflexion (Beispiele hierfür seien erlassen).
Natürlich fällt das zuerst auf die Hauptfigur zurück und mag ihrer Charakteristik dienlich sein. Aber es bleibt doch am Autor hängen, der ihr Stimme und Kontur gibt, aber herzlich wenig Überzeugungskraft. Überdies will er sein sperriges, fortwährend nach Tiefsinn strebendes, letztlich jedoch ziemlich ungereimtes Erzählwerk auch noch auf ein Symbolsystem astronomischer Begrifflichkeiten bringen (das irgendwie auch den seltsamen Titel erklärt - wie genau, bleibt unklar) und obendrein als Bildwerk präsentieren (ein "Diptychon" mit zwei "Paneelen" und einem "Scharnier"). Das aber ist des Guten entschieden zu viel und vor allem viel zu bemüht.
Was von diesem Romanfindling aus fernen Zeiten daher einzig in Erinnerung bleibt, ist sein Mosaik der jungen bundesrepublikanischen Übergangsgesellschaft, die der Erzähler ruhelos durchstreift und wie in Schnappschüssen festhält. Das liest sich streckenweise so, als sei der frühe Heinrich Böll zusammen mit Jack Kerouac durch Heidelberg gefahren. Kennern der deutschen Literatur jener Zeit mag zusätzlich noch von Interesse sein, dass diese Passagen sich zum Teil als Schlüsselroman lesen und historisches Personal auftreten lassen. Vor allem geht es um die unglückliche Lebensgeschichte des Lyrikers, Übersetzers und Verlegers Rainer Maria Gerhardt, Entdecker und Vermittler der amerikanischen Avantgarde, der sich mit 27 Jahren das Leben nahm. Andersch hat ihm 1954 einen Nachruf, Enzensberger in "Verteidigung der Wölfe" ein Gedicht gewidmet. Haldeman, der sich mit seiner Witwe anfreundete, zeichnet aus ihrer Sicht ein durchaus bewegendes Porträt dieses Genies, das an der Stumpfheit seiner Zeit zerbricht - Spiegelfigur zugleich des Romanautors.
Alles in allem gewiss eine Entdeckung. Im Unterschied zu "Stoner" aber (an den die stärkeren Erzählstrecken entfernt erinnern) keine, die man lesen muss.
TOBIAS DÖRING
Charles Haldeman:
"Der Sonnenwächter". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Egbert Hörmann und Uta Goridis, mit einem Nachwort von Martin Meyer. Metrolit, Berlin 2015. 336 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
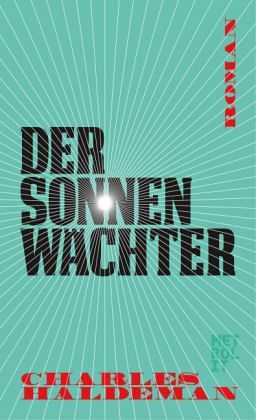




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2015