besteht aus drei Teilen. Im ersten wird die Geschichte der SBZ/DDR 1945-1990 detailliert, kenntnisreich und übersichtlich abgehandelt. Vor jedem Abschnitt finden sich instruktive Zusammenfassungen und Zeittafeln. Stichworte am Rande des laufenden Textes erleichtern zusätzlich die Orientierung.
Im zweiten Teil geht es um die Strukturen der DDR-Gesellschaft, also eine systematische Analyse, bei der natürlich das politische System, die SED-Herrschaft, an erster Stelle breit behandelt wird. Die DDR kannte keine autonome gesellschaftliche Entwicklung, nichts davon. Es handelte sich bei ihr, zumal am Anfang, um einen ideologisch motivierten Umgestaltungsprozeß, der mit unerhört harter Hand verlustreich vorangetrieben wurde. Daher läßt Schroeder den SED-Kapiteln das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) folgen, "Schild und Schwert der Partei".
Staatssicherheit war die Existenzfrage des Regimes. Das blieb, vor allem bei westlichen Linken, zu DDR-Zeiten allzuoft unterbelichtet, wurde oft verlegen oder verlogen ganz ausgespart. Man kann gar nicht häufig genug daran erinnern, daß auf 62 DDR-Einwohner ein Mitarbeiter des MfS kam. Allerdings sollten wir auch immer im Gedächtnis behalten (was Schroeder unterstreicht), daß "bei weitem nicht alle angesprochenen IM-Kandidaten zur Zusammenarbeit mit dem MfS bereit" waren; "viele verweigerten eine Mitarbeit oder stiegen durch ,Passivität' wieder aus."
Anschließend wird die DDR-Opposition vorgestellt, sehr abgewogen die Rolle der Kirchen zwischen Anpassung und Widerstand zu bewerten versucht. In diesem Zusammenhang kommt beispielsweise zur Sprache, was Schroeder die "Selbstüberschätzung" Manfred Stolpes nennt. Der IM "Sekretär" habe von seiner Kirchenleitung zwar ein Mandat für offizielle Gespräche mit staatlichen Stellen, keinesfalls jedoch für Treffen in konspirativen Wohnungen und ähnliches erhalten. Die Geheimdiplomatie des Konsistorialpräsidenten habe zwar zur Lösung humanitärer Fragen beigetragen, doch Negativeffekte hätten überwogen.
In weiteren Kapiteln geht es um die Wirtschaftsordnung, das Sozialsystem, soziale Schichtungen: die schlechthin entscheidende politische Machtelite ganz oben, darunter die administrative Dienstklasse, dann die breiten Mittelschichten, zuletzt die Unterschicht der angelernten Arbeiter, landwirtschaftlichen Hilfskräfte, einfachen Angestellten sowie die große Mehrzahl der Rentner. "Ideologie und Lebenswirklichkeiten im SED-Staat" bilden einen dritten Abschnitt dieses zweiten Hauptteils, in dem es um die SED-Ideologie, um Bildung, Erziehung und Medienpolitik ebenso geht wie, besonders interessant, um das Alltagsleben.
Im dritten und letzten Teil geht es um die "Determinanten und Entwicklungslinien der DDR-Geschichte", also die theoretische Interpretation, die Bewertung des Regimes in seinen verschiedenen Phasen. Wie soll man seinen Charakter fassen? Zu Beginn ging es sofort um die entschlossene, brutale Sowjetisierung, die Errichtung der terroristischen Monopolherrschaft einer bolschewistischen Partei, die frühzeitig begann, bereits mit der Vereinigung von KPD und SPD zur SED im Frühjahr 1946 ihren Anfang nahm.
Aber wie war es später? War die DDR am Ende kein totalitäres System mehr, sondern nur noch ein autoritäres? Hatte sich die Bevölkerung so sehr an das Regime gewöhnt, daß offener Terror nicht mehr nötig schien, jedenfalls in Friedenszeiten? Waren die Gängelung und Einschüchterung der Bevölkerung tatsächlich zurückgegangen? Hatte sich die SED-Herrschaft, wie man damals im Westen gern glauben wollte, vielleicht liberalisiert? Trotz MfS wurde in den achtziger Jahren denkbar, was in den vierziger und fünfziger Jahren jeden nach Bautzen oder gar nach Sibirien gebracht hätte. Wer den Unterschied zwischen der frühen Ulbricht-Ära und der späten Honecker-Zeit nicht sieht, kann das Ende der DDR nicht begreifen.
Wie läßt sich das verschwundene Regime also insgesamt angemessen kennzeichnen? In ruhigem Ton zeichnet Schroeder die Irrwege westdeutscher, angeblich systemimmanenter, also verharmlosender Bewertungen des Regimes seit den sechziger Jahren nach, schildert die verständlicherweise anders akzentuierten Sichtweisen seit 1990. Am Ende plädiert er dafür, die DDR als einen "sowjetischen deutschen Teilstaat" oder auch einen "(spät-)totalitären Versorgungs- und Überwachungsstaat" zu kennzeichnen. Wieso spät? Wieso Versorgungsstaat? Man merkt, was gemeint ist, auch wenn sich vielleicht weniger sperrige Formulierungen finden ließen.
Schroeder hätte übrigens noch deutlicher die Fremdbestimmung der DDR herausstellen sollen: Dieses gewaltsam errichtete, künstliche Gebilde war von Anfang bis Ende ein Kind der Sowjetunion, blieb immer abhängig. Es mußte zugrunde gehen, als Moskaus Unterstützung 1989 ausblieb. Ohne die russischen Panzer wäre die DDR schon im Juni 1953 zusammengebrochen.
Schroeder, der durchweg ruhig und zurückhaltend argumentiert, betont in seiner Einleitung, dieses Buch habe nur mit Unterstützung von Mitarbeitern des Forschungsverbundes SED-Staat in vergleichsweise kurzer Zeit verfaßt werden können. Insofern ist Schroeders Standardwerk, das heute nirgendwo seinesgleichen hat, das bemerkenswerte Ergebnis intensiver Zusammenarbeit einer besonders motivierten Gruppe junger Wissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Es ist zugleich das bisher schönste Geschenk, das dieser Universität im 50. Jahr ihres Bestehens gemacht worden ist.
ARNULF BARING
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
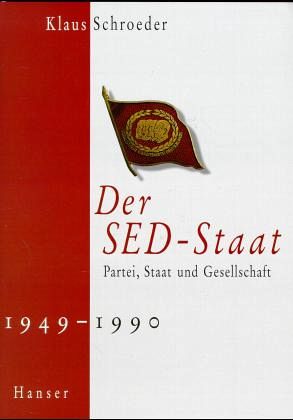





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.1998
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.1998