einen wichtigen Kontrapunkt. In seinem unaufgeregten Buch skizziert er zunächst die Entwicklung des Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland seit 1945. Daraufhin diskutiert er einschlägige Erklärungsansätze und Umfragen.
Schroeder sensibilisiert für genauere Unterscheidungen. Wer Begriffe überdehne, könne kaum die Wirklichkeit präzise erfassen. Mehrfach kritisiert er deshalb expansive Definitionen der Begriffe Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus - beides Begriffe, die manche Studien für deckungsgleich halten. Gewiß äußerten sich fast alle Rechtsextremisten fremdenfeindlich, etwa wenn sie erklären, alle Ausländer sollten Deutschland besser verlassen. Doch warnt er davor, Befragte ohne weiteres als rechtsextrem zu bezeichnen, die zusätzliche Zuwanderung skeptisch beurteilen. Schroeder veranschaulicht methodische Probleme, indem er an eine schwammige Frage aus der Sinus-Studie erinnert: "Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen?" Halten Befragte, die hier mit Ja antworten, Hitler ohne seinen Judenmord für einen großen Staatsmann, oder meinen sie, andere bejahten eine solche Frage? Einige Autoren betrachten, so Schroeder, sogar die Ablehnung von Abtreibungen als einen Indikator für rechtsextreme Gesinnung - doch Abtreibung ist in Deutschland bekanntlich straffrei, aber rechtswidrig. Zu viele Studien stellen laut Schroeder durch ungenaue Fragen falsche Diagnosen, weshalb sie dann meist Therapievorschläge machen, die ihr Ziel verfehlen.
Nach ausführlicher Kritik an teilweise suggestiven Befragungen entwickelt Schroeder selbst einen standardisierten Fragebogen - mit vielen üblichen, aber präziser formulierten Fragen; zu den Indikatoren für eine rechtsextreme Gesinnung zählt er ein dem Nationalsozialismus nahes Geschichtsbild, Nationalismus, Biologismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Antiparlamentarismus. Im Unterschied zu anderen Studien verzichtet Schroeder auf den Indikator "Gewaltbereitschaft". Begründung: Zwar gebe es unter Rechtsextremisten viel Gewaltbereitschaft, aber auch weit darüber hinaus, und zwar ohne politische Gesinnung, nicht zuletzt unter und zwischen Ausländern und Aussiedlern. Dann hätte er allerdings weitere Indikatoren für rechtsextreme Gesinnung weglassen müssen. Mit seinen Fragebögen begibt er sich in vier deutsche Kleinstädte - Neuruppin in Brandenburg, Einbeck in Niedersachsen, Arnstadt in Thüringen und Deggendorf in Bayern. Also je zwei Städte im Osten und Westen beziehungsweise Norden und Süden, alles Orte ohne rechtsextreme Szene. In diesen vier "normalen" deutschen Städten befragen Schroeder und seine Mitarbeiter insgesamt knapp 1000 Jugendliche.
Schroeder nennt seine Ergebnisse typisch, aber nicht repräsentativ. Insgesamt verfügen, so seine Bilanz, lediglich 2,1 Prozent der Befragten über eine im engeren Sinne rechtsextreme Einstellung, bei weicheren Kriterien 6 Prozent. 13,4 Prozent äußern sich stark fremdenfeindlich, wobei Gesinnung bekanntlich nicht automatisch zu entsprechendem Verhalten führt. In Einbeck und Neuruppin tragen mehr Jugendliche ein rechtsextremes Weltbild in sich als in Arnstadt und Deggendorf. Also in diesem Punkt eher ein Kontrast zwischen Nord und Süd als Ost und West. Erwartungsgemäß plädieren mehr ost- als westdeutsche, mehr männliche als weibliche Schüler und mehr Hauptschüler als Gymnasiasten zum Beispiel für die "Reinhaltung des Deutschtums" (insgesamt knapp 15 Prozent). Besorgniserregend ist die geringe Zahl an Jugendlichen, die gegen rechtsextremes Denken immunisiert ist - 50 Prozent -, ebenso wie die hohe Ablehnung beziehungsweise Gleichgültigkeit, auf die das politische System der Bundesrepublik bei vielen Jugendlichen stößt. Schroeders Studie leidet etwas unter diversen Wiederholungen, überzeugt aber durch methodische Seriosität und abgewogene Analyse, jenseits von Dramatisierung und Verharmlosung.
Ähnlich wie Schroeder präsentiert Joachim Perels' Sammelband differenzierte Gedanken, etwa zu den Wurzeln von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in der DDR, in der bereits ein erhebliches Potential an "Prolet-Ariern" agierte. Allerdings finden sich in Perels' Buch auch zahlreiche Versuche, Grenzen zwischen politischer Mitte und Rechtsextremismus zu vernebeln, gerade auch durch stumpfe, entgrenzte Termini. Der Herausgeber befindet bereits im ersten Satz seiner Einleitung forsch: "Der Rechtsradikalismus ist kein bloßes Randphänomen." Eine Aussage, die der Titel seines Buches noch bezweifelt.
Ein Autor des Bandes unterstellt den Vertriebenenverbänden, "gewöhnlich . . . Geschichtsrevisionismus" zu betreiben. Dann allerdings äußert er sich selbst apologetisch über die Vertreibung: "Die Umsiedlung erfolgte nicht aus rassistischen, sondern antifaschistischen Gründen. Sie sollte dem damaligen Verständnis zufolge das künftige Konfliktpotential in Osteuropa verringern . . ." Hitlers Massenmord als Legitimation für die Vertreibung? Läßt sich der Diktator Stalin, zeitweise Hitlers Pakt-Partner, präzise als "Antifaschist" erfassen? Stalin agierte eher als mörderischer Expansionist und Imperialist. Wer versucht, Stalins Vertreibung zu beschönigen, kann kaum heutige Vertreibungen ächten. Perels' Buch erinnert an Kurt Tucholsky: "Der Leser hat es gut; er kann sich seine Schriftsteller aussuchen."
HARALD BERGSDORF
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
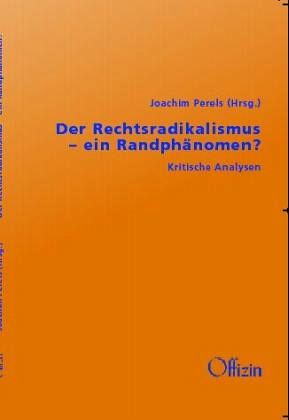




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.07.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.07.2004