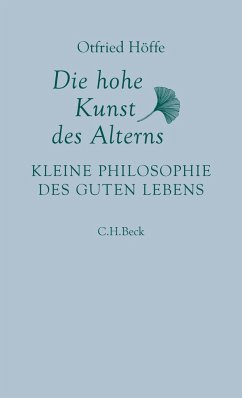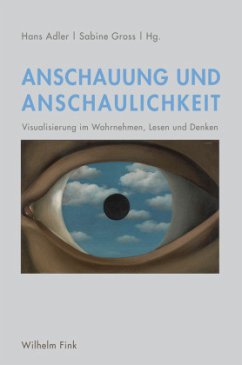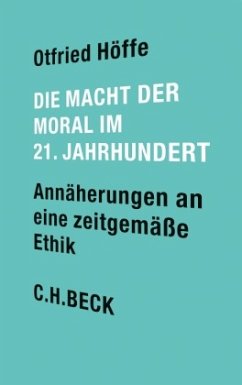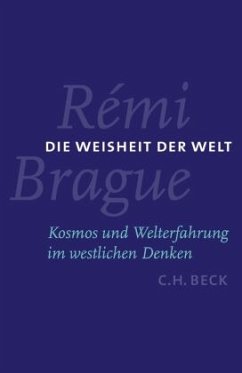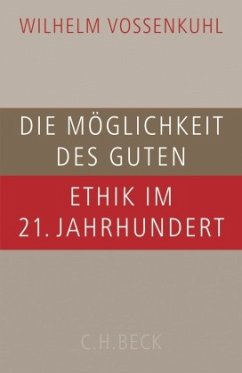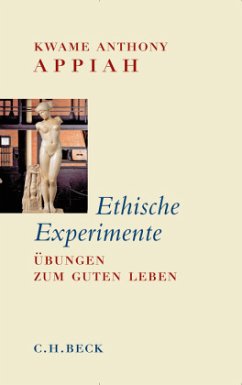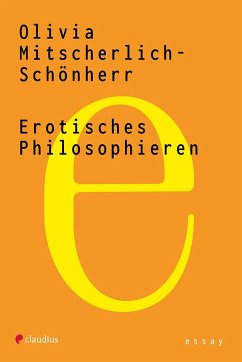neuen Position auch erklärt werden können.
Philosophische Werke suchten daher häufig das Vorbild des juridischen Prozesses, bei dem These und Gegenthese vertreten werden und am Ende der Richtspruch erfolgt. So faßt Kant die Kritik der reinen Vernunft als einen Gerichtshof, vor dem unterschiedliche Erkenntnisansprüche vorgetragen und beurteilt werden. Hegel formalisiert das kontrastive Verfahren der Philosophie als Vernunftdialektik und entwickelt die Philosophie als Summe der Vernunftwerdung.
Philosophische Dialoge nehmen das Kontrastdenken in ihre eigene literarische Form auf und verteilen das Für und Wider auf verschiedene fiktive, manchmal auch historische Gesprächspartner. Mit dieser literarischen Form wird auch die Beziehung zum Leser geändert; während das monologisch verfaßte philosophische Werk den Leser nur implizit auffordert, die Gedanken und Beweise zu prüfen und ihnen am Ende zuzustimmen, wird der Leser des Dialogs schon im Werk selbst explizit antizipiert: Der Gesprächspartner übernimmt die kritische Rolle und stimmt zu oder verweigert seine Einstimmung und vertieft so die Problemstellung. Wie in der Malerei eine Bildform entwickelt wurde, die den Betrachter selbst in das Bild versetzt ("Der Betrachter ist im Bilde"), so realisieren philosophische Dialoge die kritische Teilnahme schon im Werk selbst. Für den wirklichen Leser entsteht damit eine neue, manchmal verwirrend schwierige Aufgabe, die Platon dadurch noch labyrinthischer gestaltet, daß er Sokrates zuweilen haltlose Thesen gegen überforderte Dialogpartner aufstellen läßt.
Die Kultur des Dialogs hat sich von Platon her ausgebreitet und im achtzehnten Jahrhundert ihren vorerst letzten Höhepunkt gefunden; hierbei wurden die Grundmuster oft variiert, wobei der Typ des römischen und italienischen Villendialogs besonders erfolgreich war, in dem sich philosophisch gebildete Redner, Philosophen und Politiker zur Erörterung eines weltanschaulichen Problems treffen und in verteilten Rollen bestimmte Schulmeinungen miteinander konfrontieren.
In Vittorio Hösle neuem Buch "Der philosophische Dialog" ist Platon die Hauptfigur, daneben treten Cicero, Hume und Diderot als wichtigste Autoren auf und dann zahlreiche andere Dialog-Philosophen von Aristoteles bis Paul Feyerabend. Die Untersuchung ist klassisch in vier Teile gegliedert; auf eine ausführliche Einleitung folgen die Darstellung der Entstehungsbedingungen von Dialogen, sodann der längste Teil, die inneren Strukturen in den verschiedenen Dialogen unter dem Titel "Das Universum des philosophischen Dialogs", und am Schluß dessen Rezeption.
Das Ziel ist einmal die historische Präsentation der großen Dialogkultur in der europäischen Philosophie, zum anderen die Herausarbeitung von, wie Hösle sie nennt, allgemeinen Kategorien wie Intersubjektivität und Subjektivität. Vielleicht sollte man eher von Gesichtspunkten sprechen, die sich durchgängig bei der Analyse der Dialoge bewähren und die der Leser erfolgreich bei seinen eigenen Dialog-Entdeckungen anwenden wird.
Es ist eine Doppelaufgabe, die Hösle sich stellt: Einerseits werden die literarischen Formen und Filiationen aufgedeckt, andererseits die philosophischen kontrastierenden Argumente entwickelt. Hösle ist sich der Spannung, die in dieser Dualität liegt, bewußt und sucht sie zu bewältigen, indem er die jeweils anstehende Aufgabe genau ankündigt. Aber die Spannung liegt noch tiefer und treibt an die Grenze des Unternehmens: Die philosophischen Inhalte für sich sind in den erörterten Schriften zwar kontrastiv und dialogisch organisiert, sie können jedoch aus dem dialogischen Kontext gelöst und für sich behandelt werden. Genau dies liegt faktisch vor, wenn Argumente herausgestellt und auf ihren außerdialogischen Ursprung hin eruiert und in der Rezeption bis zur neuesten Sekundärliteratur verfolgt werden. Hier gerät die Erörterung konsequent aus dem Dialogthema in ein allgemein philosophisches, das sich in unterschiedlichen literarischen Formen darstellen läßt.
"Das Universum des philosophischen Dialogs" teilt die Erörterung in verschiedene Segmente; es gibt einzelne Dialoge und Dialoggruppen, sie unterscheiden sich nach dem realen oder nur möglichen Status einer eigenen Welt, sodann den Raum des Gesprächs, der öffentlich oder privat sein kann, da gibt es den Markt, das Gericht, die Villa, die Bibliothek, die Unterwelt; sodann die Zeit des Gesprächs, die der Autor wie bei Bühnenstücken wählt, die Zahl der Teilnehmer, die vom Selbstgespräch über das Zwiegespräch zu einer Vielzahl von Dialogpartnern führt, die Anfangs- und Ausgangssituation und das Ziel des Werkes. Die jeweiligen Gesichtspunkte werden exemplarisch vorgeführt, immer detailfreudig und akribisch im Kontakt mit der neuesten Forschung.
So sind wahrhafte Monographien zu den obengenannten vier Hauptautoren entstanden; erstaunlich sind die ausführlichen Darlegungen der Dialoge Diderots, weil Diderot im Gegensatz zu dem mit ihm ursprünglich befreundeten Rousseau kaum eine Chance hat, zu den Klassikern der Philosophie zu zählen. Kant hat ihn wenig geschätzt, und in den Werken finden sich zwar stimulierende Gedanken, aber kaum philosophische Begründungen. Es werden in ihnen materialistische Thesen aufgestellt, ohne daß Diderot sich den Schwierigkeiten einer derartigen Position zu stellen wüßte. Man wird seine Stärke eher in der Anthropologie und Psychologie sehen als in der Philosophie, aber hier stimmt Hösle auch sicher zu, der einen der Diderot-Exkurse mit einer entsprechenden Bemerkung schließt.
Das Buch ist gut geschrieben und wird niemals pedantisch, beweist philologischen Enthusiasmus und intime Kenntnis der Zusammenhänge auf dem gesamten Gebiet, das diese Monographie abschreitet. Der Verlag hat es zugelassen, Texte der europäischen Hauptsprachen im Original zu zitieren. Das ist löblich. Weniger löblich ist, daß meist keine Übersetzung beigefügt ist. Geht man so auf Leserfang? Nein, so sicher nicht. Wohl aber so: Zwei präzise Indices zu den Namen und den zitierten Stellen erschließen das Werk für das rasche Auffinden von Gedanken, an die man sich ungefähr, aber nicht mehr genau erinnert. Eine Maßnahme, die dialogfroh stimmt.
REINHARD BRANDT
Vittorio Hösle: "Der philosophische Dialog". Eine Poetik und Hermeneutik. Verlag C.H. Beck, München 2006. 480 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
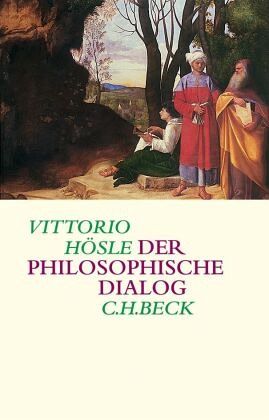




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.08.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.08.2006