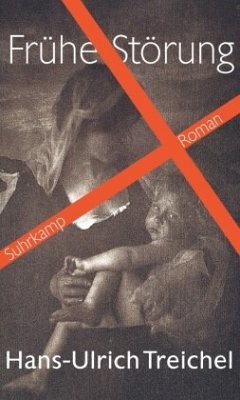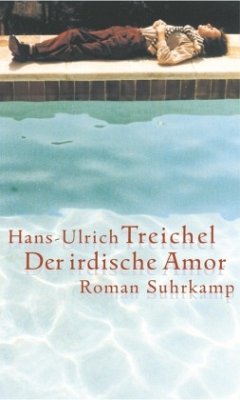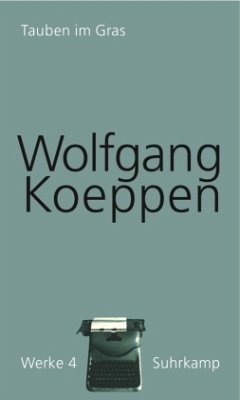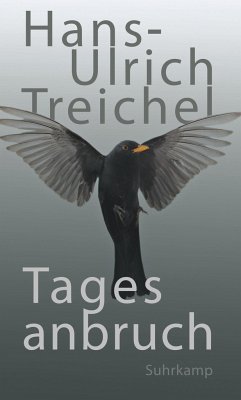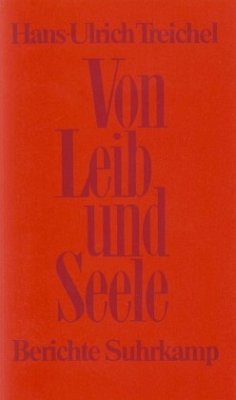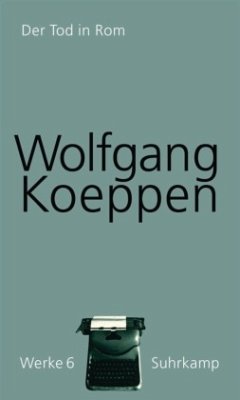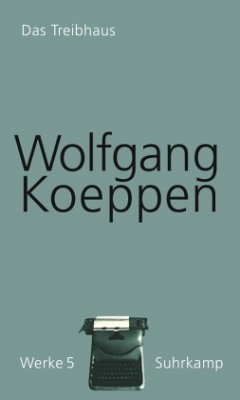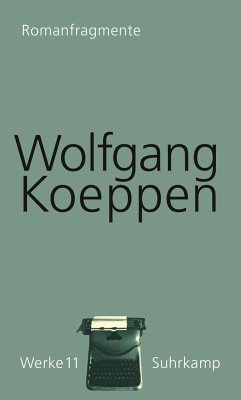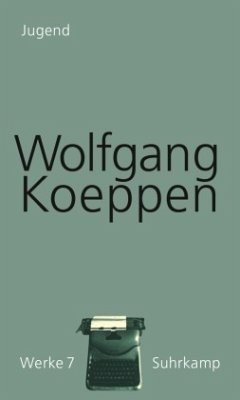deswegen.
Dabei bringt der Mann beste Voraussetzungen mit, auch fremde Wirklichkeiten zu durchdringen, hochgebildet und polyglott, wie er ist. "Ich spreche besser italienisch als so mancher Italiener" und "Ich spreche so gut englisch, wie ich atme" gibt er an: "Ich könnte auch sagen, dass ich so gut englisch spreche, wie ich Klavier spiele." Nur, im Sinne einer Fabel fängt er damit nichts an, sondern belässt es dabei, Orte, Themen und Stoffe nur anzutippen. Und damit mögliche Romane: Was etwa könnte aus der Episode werden, in der er als Lektor in Neapel einen Camorra-Boss kennenlernt und, naiv opportunistisch, dessen zweifelhafte Protektion gewinnt? Was aus dem Versuch, die Bewohner von Seaford Town, einer inzestgeschädigten deutschen Kolonie auf Jamaika, wieder anzubinden an die verlorengegangene Heimat? In dieser Prosa aber herrscht die Emphase des Akzidentellen, und so muss eine Zufallsbegegnung im Fahrstuhl mit Johannes Paul II. in Castelgandolfo, wo der namenlose Ich-Erzähler die Sommergespräche besucht, für den Titel herhalten: "Der Papst, den ich gekannt habe". Preis der Flüchtigkeit.
Aber womöglich ist das ein Kunstgriff für ein Verwirrspiel mit dem Leser, der, kaum dass er eine Fährte wittert, auch schon eine andere aufnehmen soll, assoziativ und sprunghaft. So gibt ein Motiv das nächste. Nennt der Protagonist die Stadt Reggio, erklärt er gleich, dass es sich um Reggio di Calabria handelt und dies mit Reggio nell'Emilia nicht zu verwechseln sei, und das Örtchen Caravaggio, das er in Südbrasilien besichtigt hat, bringt ihn unvermeidlich auf den berühmten Maler und die eigenen Talente, denn er "habe als junger Mensch lange Zeit nichts anderes getan, als Selbstporträts zu malen".
Die Manier des Ich-Erzählers, der eilig und eitel durch die Kulturgeschichte hüpft, entbindet nicht so sehr Komik und Selbstironie als Eloquenz und Narzissmus. Im Verlauf seines Plauderns, einer Art monologischem Smalltalk, beginnt er sich aufzulösen und gerät in den Strudel seiner Pseudologia Fantastica: Der promovierte Philologe will, da die Abiturnote für Veterinärmedizin nicht reichte, auch Zoologie studiert, dazu Sozialpädagogik belegt und eine Tischlerlehre gemacht haben.
Am Ende sitzt der Protagonist, der es nicht geschafft hat, in die vielen Notizbücher, die er sich für seine literarischen Arbeiten zulegte, auch nur eine Zeile zu schreiben, wie ein Gefangener in der großelterlichen Villa in Ostwestfalen und sinniert: "Meine Heimat ist die Welt." In der Schlusspointe beseitigt Treichel die letzten Zweifel daran, dass er, bei biographischen Gemeinsamkeiten, mit seinem Helden identisch sein könnte. Denn dieser blättert in seinen Notizbüchern, in denen nicht mehr steht als der Titel jener Geschichte, die der Leser gerade zu Ende liest. Nur gut, dass die 119 luftig bedruckten Seiten, die der Autor seiner Figur voraushat, nicht den Schriftsteller Hans-Ulrich Treichel ausmachen.
Hans-Ulrich Treichel: "Der Papst, den ich gekannt habe". Erzählung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 119 S., br., 14,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
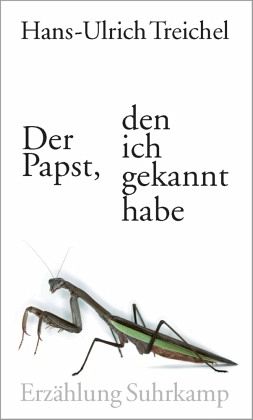





heikesteinweg_sv.jpg)
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2007