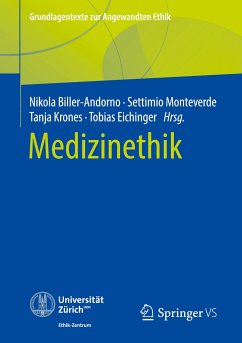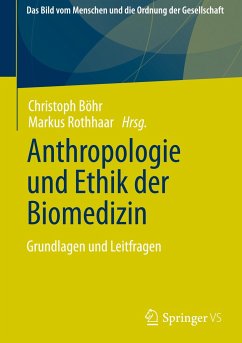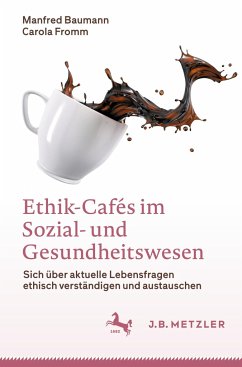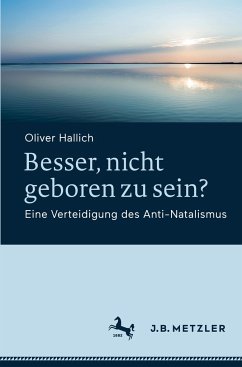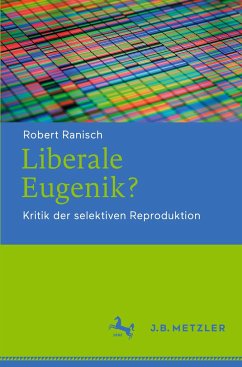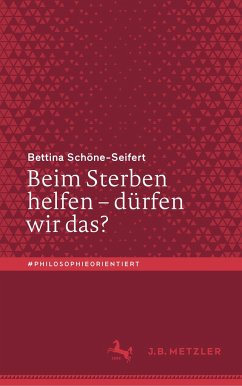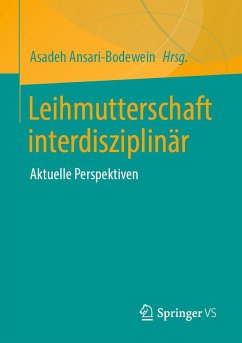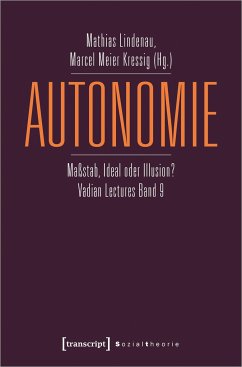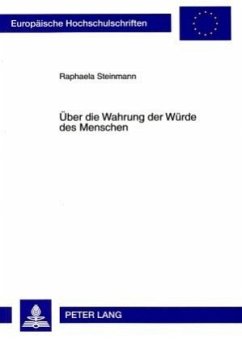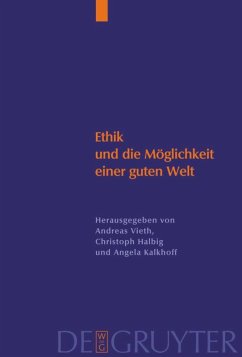sind im Kern auch viele Argumente, mit denen eine plausible Antwort auf jene Frage gefunden werden soll. Vier grundlegende Begründungsansätze für einen möglicherweise fundamentalen Status des Embryo und gegen eine sogenannte verbrauchende Forschung an ihnen lassen sich benennen: das Spezies-, das Kontinuums-, das Identitäts- und das Potentialitätsargument. Diese sogenannten SKIP-Argumente werden nun neu diskutiert, rekonstruiert, dekonstruiert und ausdifferenziert in einem überaus verdienstvollen Band, der - herausgegeben von Gregor Damschen und Dieter Schönecker - ein DFG-Rundgespräch in Kooperation mit dem Institut für Philosophie der Universität Halle-Wittenberg vom Beginn dieses Jahres präsentiert.
Die zum Teil höchst diffizilen neuen Aspekte, welche die biowissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre aufgedeckt haben, werden dabei keineswegs ausgespart, sondern sind den Scharfsinn herausforderndes Erprobungsmaterial: etwa die Frage nach möglichen Statusdifferenzen zwischen der imprägnierten Oozyte, also dem sogenannten Vorkernstadium, der Zygote und dem biologisch-autonomen Frühembryo oder der Reprogrammierung von Körperzellen. Auf durchweg hohem Niveau streiten dabei Eberhard Schockenhoff und Reinhard Merkel um das Speziesargument, Ludger Honnefelder und Matthias Kaufmann um das Kontinuumsargument, Rainer Enskat und Rolf Stoecker um das Identitätsargument sowie Wolfgang Wieland und Bettina Schöne-Seifert um das Potentialitätsargument.
Zu den Höhepunkten des Bandes gehört neben der Verteidigung des Potentialitätsarguments durch den Heidelberger Emeritus Wieland aber das umfangreiche Schlußkapitel der beiden Herausgeber, die neu akzentuierte Argumente zum moralischen Status menschlicher Embryonen in ein Plädoyer "in dubio pro embryone" münden lassen. Ihre indirekte Begründungsstrategie geht von einer weithin anerkannten Prämisse - nämlich: daß reversible Komatöse und Neugeborene nicht getötet werden dürfen - aus und versucht nachzuweisen, daß gegen den Ausschluß von Embryonen aus diesem Schutzmodell die besseren Gründe sprechen. Sie verwenden dabei durchaus plausibel auch ein Vorsichtsargument.
Die existentiellen Fragen am Anfang und Ende des menschlichen Lebens lassen sich sicher nicht auf SKIP-Argumente und formgerechte Syllogismen reduzieren. Und das moralphilosophisch wie verfassungsrechtlich zentrale Phänomen, das aus dem Gebot, die Würde des Menschen zu achten, resultiert, kann ein Verbot der sogenannten verbrauchenden Embryonenforschung möglicherweise auch jenseits oder diesseits von Spezies-, Identitäts-, Kontinuums- und Potentialitätsstrategien legitimieren. Dennoch: Gerade für das oftmals so schwierige transdisziplinäre Gespräch ist eine selbstkritische Vergewisserung über die Stringenz, Reichweite und Grenzen der je verwandten Argumentationstopoi ohne Zweifel ein Gewinn. Wer hieran in der gegenwärtigen Auseinandersetzung ernsthaft interessiert ist, dem sei das Buch nachdrücklich empfohlen.
Einer, der seit Jahren ebenso medienwirksam wie virtuos die SKIP-Klaviatur bedient, ist Reinhard Merkel. Daß der Hamburger Rechtsphilosoph und Strafrechtler dabei gelegentlich die Grenze zwischen scharfsichtig-scharfzüngiger Analyse und irritierend selbstgewissem Rationalitätspathos überschreiten mag, dürfte für manchen seiner zahlreichen Diskussionsgegner wenig erfreulich gewesen sein, verhindert aber nie eine entschiedene Antwort auf nahezu alle Zentralfragen der gegenwärtigen biopolitischen Debatte.
In dem von Damschen und Schönecker herausgegebenen Band beschränkte Merkel sich noch auf die Rolle des Spezies-Kritikers. Doch in seiner eigenen Monographie "Forschungsobjekt Embryo" setzt er gleichsam zum Rundumschlag an. Nach einer schonungslosen Demontage der Abtreibungsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts vermag Merkel am Ende nur noch eine verfassungsrechtliche Tabula rasa zu erkennen, was ihm nunmehr aber erlaubt, seine (im weiteren Sinne interessenethischen) Positionen aus dem Modus des esoterischen Raisonnements herauszuführen und ihnen die Dignität politikleitender Vernünftigkeit zu verleihen.
Manch Zustimmungswürdiges in Einzelfragen kann man durchaus vermerken, etwa die Antikritik jener Position, die im Blick auf das sogenannte therapeutische Klonen gerne eine normative und moralische Signifikanz zwischen befruchteten Eizellen und kern-transfergeschaffenen totipotenten Zellen behauptet. Doch als Grundsatzproblem bleibt die Frage, warum ausgerechnet die Leidensfähigkeit der angemessene normative Anknüpfungspunkt für die Zuerkennung verfassungsrechtlicher Integritätsansprüche sein soll. Ich vermag auch nicht zu erkennen, warum der Unterschied zwischen der Fähigkeit des reversibel Komatösen, später menschliche Eigenschaften wieder zu realisieren, einerseits und dem Vermögen des Embryo, solche Fähigkeiten zu entwickeln, andererseits auf eine Differenz zwischen Leben und Tod hinauslaufen soll (dazu finden sich in Damschens und Schöneckers Buch zutreffende Passagen).
Hierauf habe ich bei Merkel keine überzeugenden Antworten gefunden. Fündig wird der Leser aber gegen Ende der Studie in anderer Hinsicht: Beiläufig - und wohl nur dank eines Deleatur-Versäumnisses von Autor und Lektor - erfährt man, daß die Studie aus einem Gutachten (für die FDP?) entstanden ist. Nicht daß solche Entstehungsumstände als solche die Überzeugungskraft von Argumenten schwächen. Doch gehört die diesbezügliche Transparenz zu den wünschenswerten Voraussetzungen gelungener Rezeptionen, gerade dann, wenn rechtspolitische Ratschläge erteilt werden.
WOLFRAM HÖFLING
Reinhard Merkel: "Forschungsobjekt Embryo". Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an embryonalen menschlichen Stammzellen. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2002. 304 S., br., 12,50 [Euro].
Gregor Damschen, Dieter Schönecker (Hrsg.): "Der moralische Status menschlicher Embryonen". Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument. Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2002. 331 S., br., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
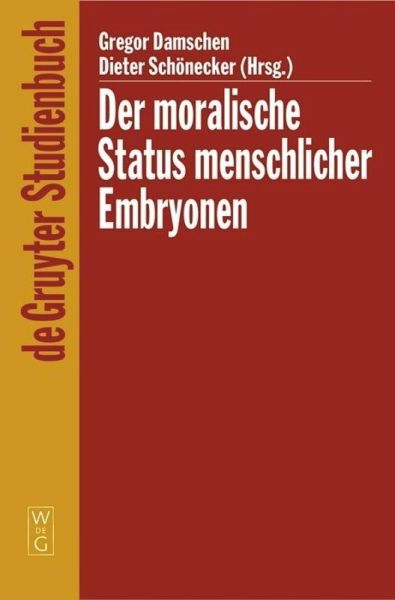




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.10.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.10.2002