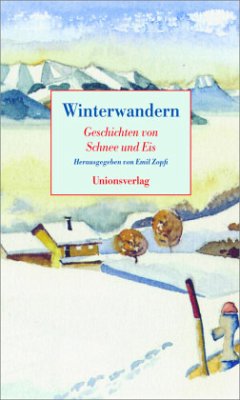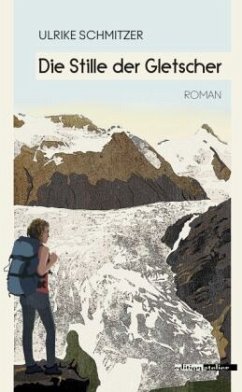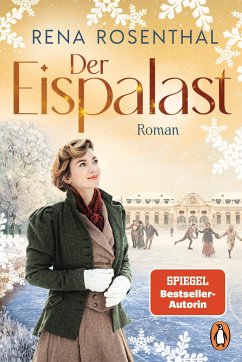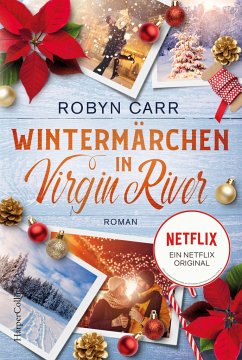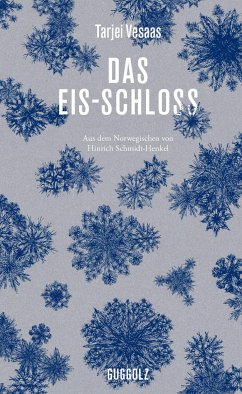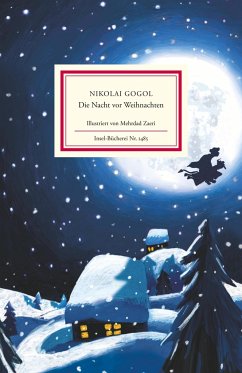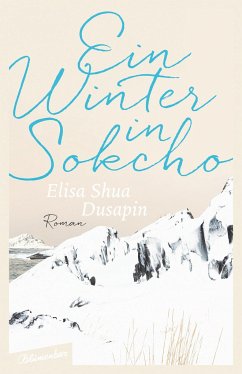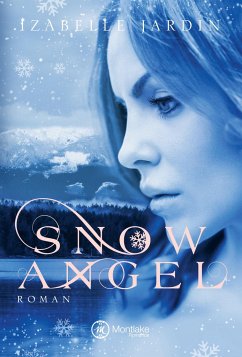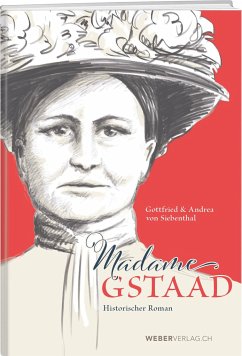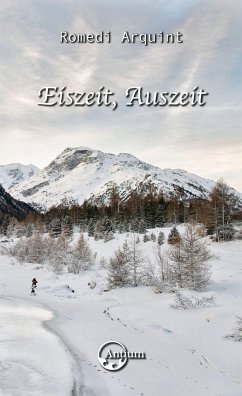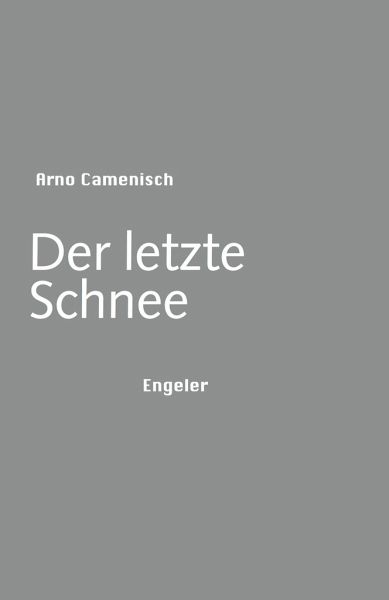
Der letzte Schnee
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
19,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein Winter in den Bündner Bergen. Was tun, wenn der grosse Schnee ausbleibt - und mit ihm die Gäste? Paul und Georg stehen wie jedes Jahr an ihrem alten Schlepplift, so schnell bringt den ordentlichen Georg nichts aus der Ruhe und den grossen Fabulierer Paul nichts zum Schweigen. Zu allem fällt ihm eine Geschichte ein, um das grosse Verschwinden aufzuhalten und die verkehrte Welt wieder ins Lot zu bringen. Er redet über die Kapriolen des Wetters und über das Glück des Lebens, er spricht über seine grosse Liebe Claire und über den Sohn, der macht, was er will. Er erzählt vom Leben in d...
Ein Winter in den Bündner Bergen. Was tun, wenn der grosse Schnee ausbleibt - und mit ihm die Gäste? Paul und Georg stehen wie jedes Jahr an ihrem alten Schlepplift, so schnell bringt den ordentlichen Georg nichts aus der Ruhe und den grossen Fabulierer Paul nichts zum Schweigen. Zu allem fällt ihm eine Geschichte ein, um das grosse Verschwinden aufzuhalten und die verkehrte Welt wieder ins Lot zu bringen. Er redet über die Kapriolen des Wetters und über das Glück des Lebens, er spricht über seine grosse Liebe Claire und über den Sohn, der macht, was er will. Er erzählt vom Leben in den Bergen, von Vorfahren und Vorbildern, von Sieg und Niederlage, Schule und Erziehung, und räsonniert über die zeitlosen Fragen nach Herkunft und Zukunft. Arno Camenisch beschreibt auf seine unverkennbar eigenwillige Art bildstark und präzise vom Ende und Verschwinden in einem Tal im Wandel der Zeit, während der Schlepplift im Hintergrund regelmässig rattert wie der Lauf der Welt.