Bezügen und Sinn-Schichten ausgestattet, welcher der Sinnlichkeit seiner flächenhaften, barock aus Voll- und Leerzonen, Licht und Schatten, konkav und konvex konstruierten Bilder mit ihren isolierten oder kühn überschnittenen Volumina nicht nachsteht.
Volumina, die Klangkörper sind und Musik als Unfaßbares anschaulich machen durch angewandte Zahlenspekulationen, in denen Harmonie und Mathematik zur Deckung gelangen, durch Wortspiele, welche musikalische Begriffe in Malerei übersetzen. Was unweigerlich zum paragone als Wettstreit unter den Künsten um den höchsten Rang führt. Er wird hier nicht nur synästhetisch durch das Ausschöpfen aller sprachlichen Doppelbedeutungen und Assonanzen geführt. Auch Kompositionsprinzipien wie das Ricercare, die Wiederholung und die Variation finden sich als Parallelen im Gemälde wieder, desgleichen Farb-Ton-Entsprechungen und die damit verbundenen ethischen Affekte, Gefühls- und Ausdruckswerte. Täuschende Staubspuren laden als Trompe-l'oeil zum Berühren der Instrumente ein, was auf die alte, hier im Geist Leonardos zugunsten der Malerei entschiedene Rivalität mit der Skulptur hinweist, aber die Stilleben auch buchstäblich zum Klingen bringt, denn ein Instrument berühren (toccare), heißt: es spielen, Töne entbinden.
Statuetten in den Bildern fordern zum direkten Vergleich mit den reliefartigen, im scharfen Licht wie abgehoben wirkenden Formen der Instrumente heraus. Es wurde zu jener Zeit durchaus erwogen, ob Lautenbauer nicht eher Künstler als Handwerker seien - eine Ansicht, die von Liebhabern dieser wundervollen Objekte noch immer geteilt wird.
Die Untersuchung von Gian Casper Bott stellt nicht nur akribisch alle diese Facetten dar. Sie stellt sich auch selbst, nicht ohne Humor, in die Tradition solcher gelehrten Spiele, was unter anderem zu einer gelungenen Bildzuschreibung und zu einem anschließenden Exkurs über Instrumentenerotik führt, der die Anbindung an den aktmäßig hingestreckten violone des Anfangs wiederherstellt. Zum Eintauchen in die Mehrdeutigkeit der reichlich zitierten Texte sind allerdings gewisse Italienischkenntnisse nicht ganz überflüssig. GÜNTER METKEN.
Gian Casper Bott: "Der Klang im Bild". Evaristo Baschenis und die Erfindung des Musikstillebens. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1997. 199 S., 50 Abb., 8 Farbtafeln, br., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
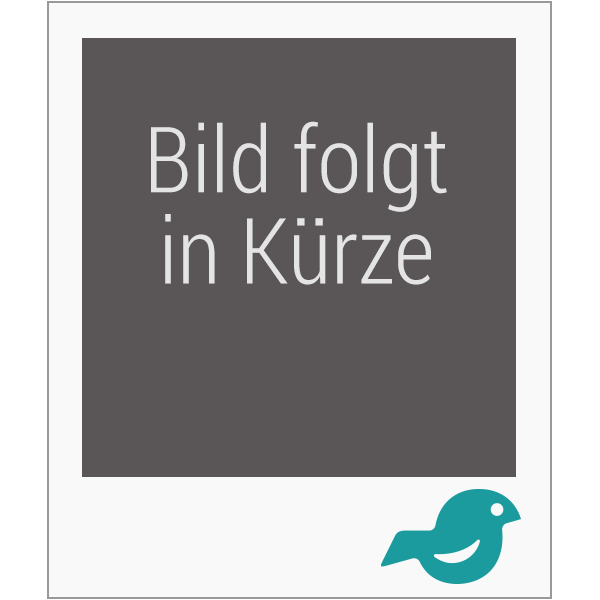




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.02.1998
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.02.1998