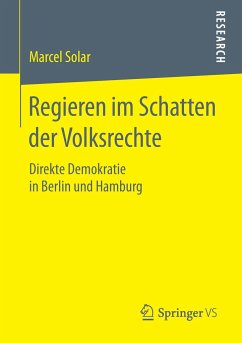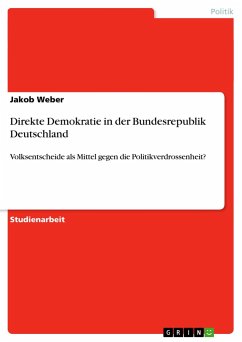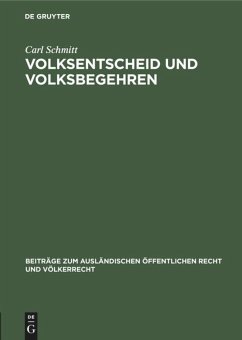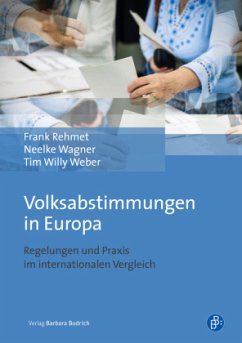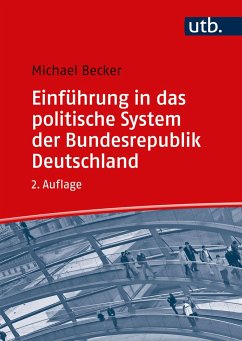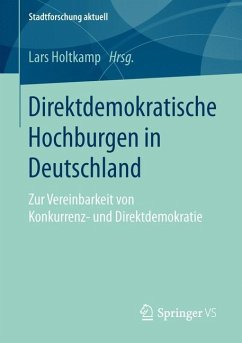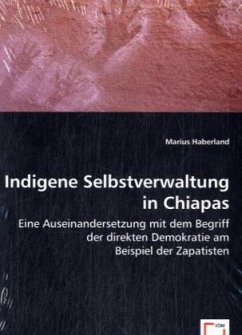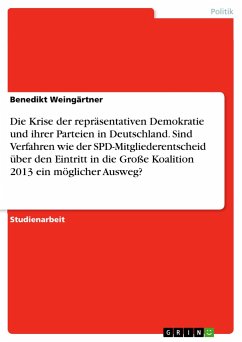Demokratie ist also höchst aktuell und umso dringender, als derzeit durchaus ein Repräsentationsdefizit angesichts der Konsenskultur der etablierten Parteien konstatiert wird. Der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker zieht in seiner "Streitschrift" das Resümee aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit der direkten Demokratie. Ein Verdienst liegt in der akribischen Differenzierung der unterschiedlichen Ausprägungen der "Volksrechte", die manchmal allerdings so weit geht, dass sich der Verfasser selbst in der Begrifflichkeit zu verheddern scheint. Demokratietheoretisch werden die plebiszitären Entscheidungsrechte zwischen Konstitutionalismus und Volkssouveränität verortet. Da direktdemokratisch entscheidende Bürger immer auch stellvertretend für andere wie Kinder und zukünftige Generationen abstimmen, unterscheidet Decker nicht zwischen repräsentativer und plebiszitärer Demokratie, sondern zwischen parlamentarischer und plebiszitärer Repräsentation.
Die zentrale Frage gilt der Verträglichkeit plebiszitärer Beteiligungsformen mit dem parlamentarischen System. Dabei konzentriert sich der Verfasser auf die Volksgesetzgebung, also auf Verfahren, die vom Bürger selbst, nicht von der Regierung oder vom Parlament in Gang gesetzt werden. Die zentrale und überzeugende These des Buches lautet, dass "von unten" ausgelöste Verfahren "mit der gewaltenfusionierenden Funktionslogik der parlamentarischen Demokratie kollidieren". Die Wurzeln der vom Verfasser als Glaubenskrieg etikettierten Volksgesetzgebung werden ideen- und verfassungsgeschichtlich etwas kursorisch bei dem frühsozialistischen Paulskirchen-Abgeordneten Moritz Rittinghaus und beim südwestdeutschen Liberalismus aufgespürt. Informativ ist die Übersicht über die direktdemokratischen Regelungen und Erfahrungen in den Verfassungen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutschland auf Länderebene.
Die Anpreisung des Buches könnte den Eindruck erwecken, dass der Verfasser überhaupt gegen die direkte Demokratie sei. Doch weit gefehlt! Auch bei einem Verzicht auf die Volksgesetzgebung kann er sich vorstellen, das Grundgesetz um plebiszitäre Verfahren zu ergänzen: etwa durch ein obligatorisches Referendum über Kernfragen der Verfassung, durch ein vom Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit beschlossenes Entscheidungsreferendum oder durch eine Vetoinitiative im Hinblick auf von der Legislative beschlossene Gesetze. Auf Länderebene könnten die Friktionen zwischen Parlamentarismus und Volksgesetzgebung durch die Einführung präsidentieller Regierungssysteme, nach dem Modell der Kommunalverfassungen behoben werden. In ein System der Gewaltentrennung fügten sich nämlich plebiszitäre Initiativen "von unten" besser ein als in das gewaltenfusionierende System des Parlamentarismus. Den Länderparlamenten komme ohnehin im Wesentlichen nur die Kontrolle der Verwaltung zu, die durch das Gegenüber von Regierung und Opposition eher erschwert werde.
Das lesenswerte Buch breitet die zahlreichen Facetten der direkten Demokratie aus, regt zur theoretischen Reflexion, aber auch zur empirischen Forschung an. Die praktischen Vorschläge sind eher im Bereich der wissenschaftlichen Spielerei anzusiedeln.
WOLFGANG JÄGER
Frank Decker: Der Irrweg der Volksgesetzgebung. Eine Streitschrift. Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2016. 184 S., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.01.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.01.2017