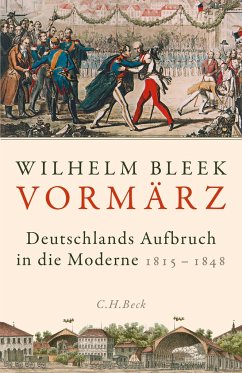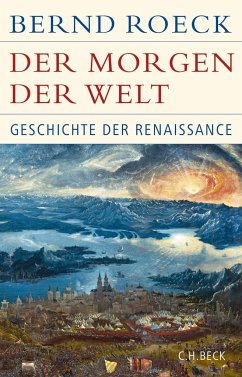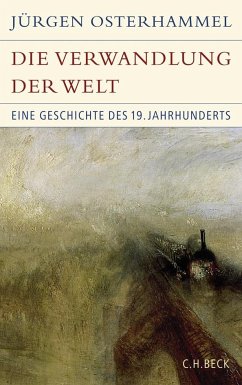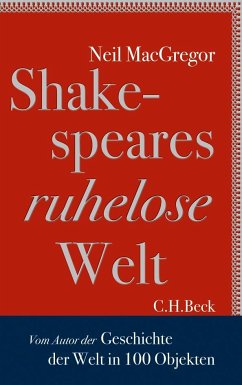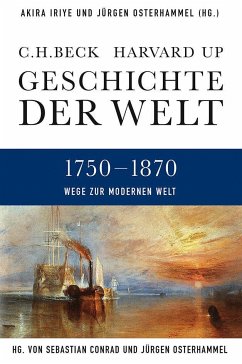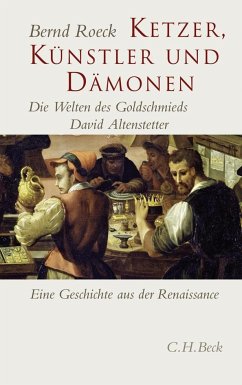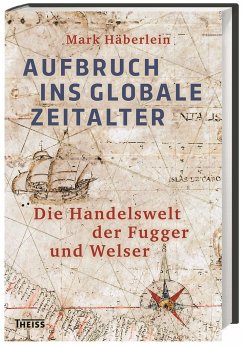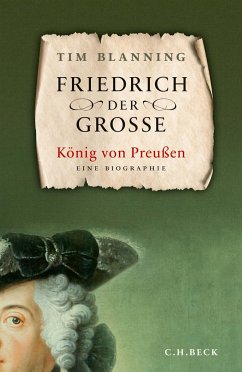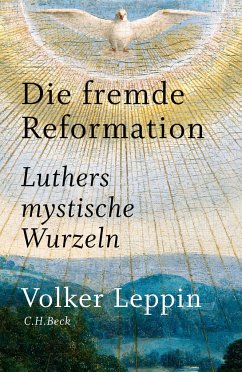Der große Aufbruch
Globalgeschichte der Frühen Neuzeit

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
ALS DIE WELT GRÖßER WURDE - WOLFGANG BEHRINGERS FULMINANTE GLOBALGESCHICHTE DER FRÜHEN NEUZEITMit der europäischen Entdeckung Amerikas und der Etablierung des Schiffsverkehrs zwischen den Kontinenten begann eine neue Epoche der globalen Geschichte. Die Kontakte und der Austausch zwischen den Zivilisationen dieser Welt wurden immer vielfältiger ? damit freilich auch die Konflikte. in seinem fulminanten, bravourös geschriebenen Buch entfaltet Wolfgang Behringer ein weltumspannendes Panorama der Frühen Neuzeit, das die Entwicklungen aus der Perspektive aller beteiligten Kulturen schildert ...
ALS DIE WELT GRÖßER WURDE - WOLFGANG BEHRINGERS FULMINANTE GLOBALGESCHICHTE DER FRÜHEN NEUZEIT
Mit der europäischen Entdeckung Amerikas und der Etablierung des Schiffsverkehrs zwischen den Kontinenten begann eine neue Epoche der globalen Geschichte. Die Kontakte und der Austausch zwischen den Zivilisationen dieser Welt wurden immer vielfältiger ? damit freilich auch die Konflikte. in seinem fulminanten, bravourös geschriebenen Buch entfaltet Wolfgang Behringer ein weltumspannendes Panorama der Frühen Neuzeit, das die Entwicklungen aus der Perspektive aller beteiligten Kulturen schildert und dadurch ein ganz neues Bild dieser Zeit präsentiert.
Im Mittelpunkt dieser neuartigen Geschichte der Frühen Neuzeit stehen globale Ereignisse, die den Gang der Weltgeschichte veränderten, globale Orte, die Knotenpunkte des Austauschs bildeten, globale Themen und Strukturen wie Kolonialismus und Rassismus. Wolfgang Behringer nimmt die Leserinnen und Leser mit auf die Reise nach Afrika und Amerika ebenso wie nach Indien und Indonesien, nach Russland, China und Japan und durch das damalige Europa, das seinen zivilisatorischen Rückstand gerade erst aufholte. Sein Buch beschreibt die großen Zusammenhänge und erzählt gleichermaßen von einzelnen Menschen, die diese Zeit erlebten und gestalteten. Es schildert die Weltgeschichte einer großen Epoche für unsere Zeit und ist zugleich ein wahres Lesevergnügen.
Das Opus Magnum von Wolfgang Behringer Eine Globalgeschichte auf der Höhe unserer Zeit Grandios erzählt Wolfgang Behringer ist einer der besten Historiker der frühen Neuzeit
Mit der europäischen Entdeckung Amerikas und der Etablierung des Schiffsverkehrs zwischen den Kontinenten begann eine neue Epoche der globalen Geschichte. Die Kontakte und der Austausch zwischen den Zivilisationen dieser Welt wurden immer vielfältiger ? damit freilich auch die Konflikte. in seinem fulminanten, bravourös geschriebenen Buch entfaltet Wolfgang Behringer ein weltumspannendes Panorama der Frühen Neuzeit, das die Entwicklungen aus der Perspektive aller beteiligten Kulturen schildert und dadurch ein ganz neues Bild dieser Zeit präsentiert.
Im Mittelpunkt dieser neuartigen Geschichte der Frühen Neuzeit stehen globale Ereignisse, die den Gang der Weltgeschichte veränderten, globale Orte, die Knotenpunkte des Austauschs bildeten, globale Themen und Strukturen wie Kolonialismus und Rassismus. Wolfgang Behringer nimmt die Leserinnen und Leser mit auf die Reise nach Afrika und Amerika ebenso wie nach Indien und Indonesien, nach Russland, China und Japan und durch das damalige Europa, das seinen zivilisatorischen Rückstand gerade erst aufholte. Sein Buch beschreibt die großen Zusammenhänge und erzählt gleichermaßen von einzelnen Menschen, die diese Zeit erlebten und gestalteten. Es schildert die Weltgeschichte einer großen Epoche für unsere Zeit und ist zugleich ein wahres Lesevergnügen.
Das Opus Magnum von Wolfgang Behringer Eine Globalgeschichte auf der Höhe unserer Zeit Grandios erzählt Wolfgang Behringer ist einer der besten Historiker der frühen Neuzeit