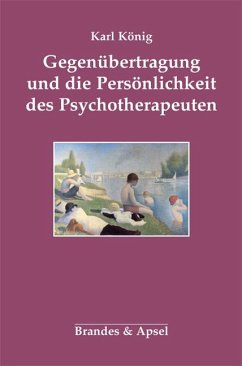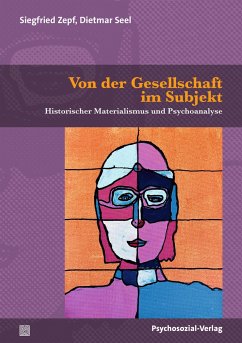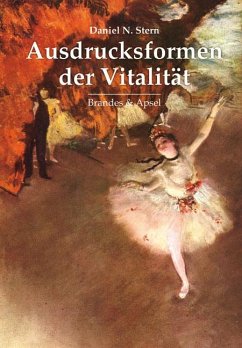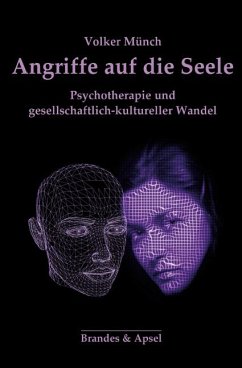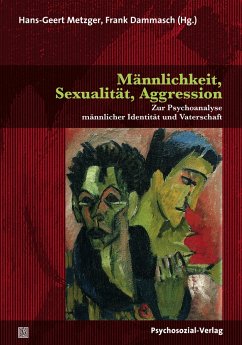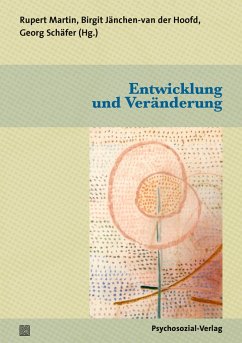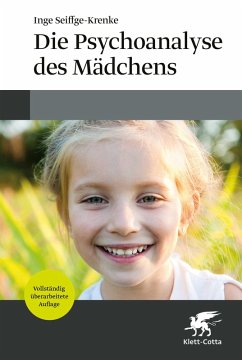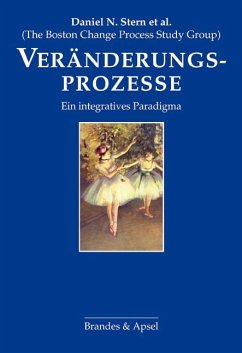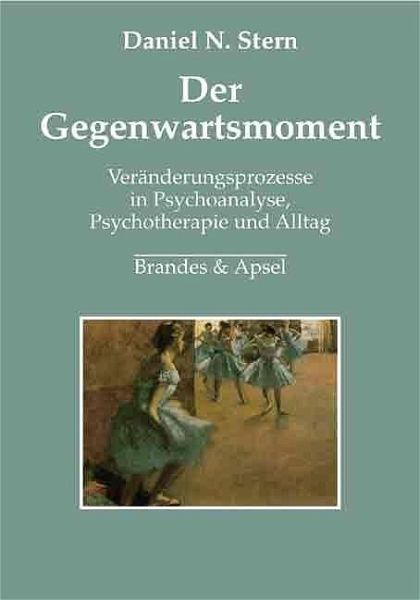
Der Gegenwartsmoment
Veränderungsprozesse in Psychoanalyse, Psychotherapie und Alltag
Übersetzer: Vorspohl, Elisabeth
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
29,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Obwohl das "Hier und Jetzt" unser Alltagsleben überaus stark beeinflußt und wir subjektiv nur "jetzt" lebendig und bewußt sind, hat man über den Gegenwartsmoment in der alltäglichen Wahrnehmung überraschend wenig nachgedacht. Daniel N. Stern, international bekannter Verfasser von Bestsellern wie Die Lebenserfahrung des Säuglings und Tagebuch eines Babys, beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit jenen Gegenwartsmomenten intensiver und gelebter Erfahrung, die nur sekundenlang andauern, aber häufig tiefe Wahrheiten über unsere Psyche und unsere Erlebensweise offenbaren. Dieses Buch set...
Obwohl das "Hier und Jetzt" unser Alltagsleben überaus stark beeinflußt und wir subjektiv nur "jetzt" lebendig und bewußt sind, hat man über den Gegenwartsmoment in der alltäglichen Wahrnehmung überraschend wenig nachgedacht. Daniel N. Stern, international bekannter Verfasser von Bestsellern wie Die Lebenserfahrung des Säuglings und Tagebuch eines Babys, beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit jenen Gegenwartsmomenten intensiver und gelebter Erfahrung, die nur sekundenlang andauern, aber häufig tiefe Wahrheiten über unsere Psyche und unsere Erlebensweise offenbaren. Dieses Buch setzt sich mit höchst schwierigen, aber faszinierenden Fragen nach dem Wesen der "Jetztheit" und der Art und Weise auseinander, wie das "Jetzt" zwischen zwei Menschen erlebt wird. Dabei geht es Stern um die Beziehung zwischen Gegenwartsmomenten und therapeutischer Entwicklung und Veränderung. Stern erläutert die Unberechenbarkeit und "Ungenauigkeit" des therapeutischen Prozesses und untersucht, wie Vergangenheit und Gegenwart in der Therapie aufeinanderprallen und im Moment ihrer Kollision Möglichkeiten zu Veränderung und Weiterentwicklung eröffnen können. Indem er den Gegenwartsmoment ins Zentrum der Psychotherapie rückt, läßt Stern wichtige Themen in einem ganz neuen Licht erscheinen, etwa die Fragen, wie sich therapeutische Veränderung vollzieht, was in einer Therapie wirklich wichtig ist und wie unser Zusammensein mit dem Anderen unsere Vergangenheit umschreiben und unsere Zukunft verändern kann.