lebenslange Zuchthausstrafe um. Am 16. August drangen 25 bewaffnete Männer in das Gefängnis ein und entführten Leo Frank. Sie brachten ihn nach Mariette, dem Geburtsort der Ermordeten, kastrierten ihn und hängten ihn vor einer johlenden Menge auf. Fotos wurden geschossen, eines kursierte als Postkarte noch jahrelang in den Südstaaten. Von den Lynchmördern wurde kein einziger verfolgt, geschweige denn verurteilt. Die Anzeichen für Franks Unschuld mehrten sich, viele Jahre später meldete sich ein Zeuge, der das Geständnis eines schwarzen Pförtners zu Protokoll gab, er habe Mary Phagan getötet. 1986 wurde Leo Frank offiziell rehabilitiert, 70 Jahre nach seiner Ermordung.
Der Fall Leo Frank ist in den Vereinigten Staaten fast so bekannt wie die Dreyfus-Affäre. Er ist komplett aufgearbeitet, gut dokumentiert und in Georgia Schulstoff; er hat als Vorlage zu etlichen Büchern, einer TV-Dokumentation und sogar einem Musical gedient. Im Internet kann man alte Zeitungsausschnitte darüber lesen und Bilder von Frank und seiner Familie betrachten, auch die Lynch-Postkarte ist vorhanden, aber passwortgeschützt. Leo Frank ist, wenn nicht alles täuscht, das einzige jüdische Opfer weißer Lynchjustiz gewesen, neben Tausenden von Schwarzen. Sozialhistoriker erklären den Gewaltausbruch in Atlanta mit einem starken Modernisierungsschub im Süden der Vereinigten Staaten, der die Mittelschichten verunsicherte, und mit Frank als dreifach geeigneten Sündenbock: Er war reich, aus dem Norden und Jude.
Überlegungen solcher Art beschäftigen David Mamet wenig. Der überaus erfolgreiche amerikanische Dramatiker ("Oleanna") und Filmautor (Dutzende Drehbücher, von "The Postman always rings twice" bis "Wag the dog") hat aus dem Casus seinen zweiten Roman gemacht, und so heißt er auch in deutscher Übersetzung: "Der Fall Leo Frank". Der Originaltitel "The Old Religion" weist in eine andere, in die richtige Richtung. Mamet setzt die historischen Ereignisse als bekannt voraus und konzentriert sich ganz auf das innere Geschehen. Er zeigt, wie sich ein Bewusstsein unter Verfolgungsdruck verändert. Auf seine Stärke, auf szenische und dialogische Partien, hat der Theaterautor weitgehend verzichtet, es dominieren die Reflexionen des unschuldig Angeklagten. Auch an äußerer Spannung ist Mamet keineswegs gelegen. Der Ausgang ist bekannt, und auch dem Helden erscheint der Prozess von Anfang an als ein abgekartetes Spiel.
Der Angeklagte dient der vordergründig selbstzufriedenen, in Wahrheit verstörten Südstaaten-Gesellschaft zur Bestätigung ihrer Vorurteile; er ist der Mörder, weil er es sein muss. Deshalb verschwinden entlastende Beweismittel, schwören Zeugen Meineide und geht der eigentliche Täter frei aus. Der Prozess ist ein Ritual der Selbstvergewisserung.
Das hat Leo Frank, der dem Verfahren fast somnambul beiwohnt, fein durchschaut. Keiner ist dazu so geeignet wie er, ein Virtuose der Selbstbeobachtung und des Selbstzweifels. Anlass der Übung: seine Sonderstellung als Jude. Die wird, je mehr ignoriert, desto stärker empfunden. Das zeigt Mamet auf brillante Weise schon auf den ersten siebzig Seiten (den besten des Buches), da Frank sich noch in Freiheit befindet und mit seinen Glaubensbrüdern über Gräuelmärchen aus ferner Pogromzeit scherzt - eine gespenstische Szene, die nur der Schrecken der letzten Seite einholt. Nichts ist unschuldig, nichts selbstverständlich; was immer er tut, er tut es als Jude. Jeder Handlung haftet diese Auszeichnung, dieser Makel an. Aus solchen kleinen Steinchen setzt Mamet das Bild eines Opfers zusammen, das nur noch auf das Fallbeil der Anklage wartet, die es sogleich zu einem toten Mann macht. Schwer, hier nicht an Kafkas "Prozeß" zu denken.
Vom Moment der Anklage an ist Frank allein. Selbst die jüdische Gemeinde ist unangenehm berührt: Ein jüdischer Mörder ist natürlich "schlecht für die Juden". Keiner zweifelt an seiner Schuld; die Unschuldsvermutung ist ein Relikt eines bloß formal übernommenen, aber nicht wirklich angenommenen Rechtssystems, das in der Realität durch die Diktatur der Wohlmeinenden und Rechtgläubigen ersetzt ist. Was setzt Leo Frank, dem Glauben seiner Väter längst entfremdet und natürlich ein glühender Anhänger der Aufklärung, an die Stelle von Recht, Gesetz und Vernunft, wenn die sich derart schwach und unverlässlich erweisen? "The Old Religion" soll es sein. Zeigte Frank als freier Mann noch heftige Ablehnung gegenüber der Spitzfindigkeit jüdischer Speisegebote ("Idioten"), so nimmt er im Gefängnis Hebräisch-Stunden und platziert sich immer stärker außerhalb jener Gemeinschaft, zu der er immer gehören wollte: der der Christen.
Während antisemitischer Phasen in der Geschichte ist es häufig zu beobachten, dass "weltliche" Juden ihre Illusionen über eine geglückte Assimilation über den Haufen werfen und sich der Orthodoxie zuwenden, als eines letzten Hafens der Zugehörigkeit. Leo Frank nun kann in diesem Hafen nicht ankern. Der Rabbi, bei dem er Stunden nimmt, ist keine rechte Hilfe, die Sprache widerspenstig, ihr verborgener Sinn ein verworrener. Genauso wie die Schriftzeichen "Shin. Lamed. Tof" lässt sich auch etwa die Inschrift "Ginnett and Hubbard. Penal Engineering. Booth, Ohio" geometrisch neu anordnen und nach versteckten Botschaften durchsuchen. Frank macht die Probe aufs Exempel. Ein müßiger Zeitvertreib, eine Sackgasse. Franks säkularisierter, durch die Außenseiterrolle zusätzlich geschärfter Verstand ist zu weit entfernt vom Judentum, um dort wieder Wurzeln schlagen, sich durch Vokabeln und Listen disziplinieren, ablenken und beruhigen zu können. Unbeirrbar fragt dieser Verstand nach dem Sinn des ihm Zugestoßenen. Aber anders als Hiob kann er nicht hadern, dazu fehlt ihm der persönliche, verantwortliche Gott als Widerpart. Frank muss ihn erst schaffen. Was könnte das für ein Gott sein? Und welchen Platz hätte er wiederum in einer wie gearteten Gotteserfindung?
Das sind nun, quasi im Angesicht des Galgens, keineswegs mehr müßige Überlegungen. Sie quälen ihn allerdings mehr, als sie ihn weiterführen. Der Sprung auf eine höhere Ebene gelingt erst dem geschwächten, fiebernden, Blut hustenden Patienten der Krankenstation, der eine Messerattacke eines Mithäftlings knapp überlebt hat. Hier phantasiert sich Frank in eine Nachfolge Christi hinein: Indem er sich schuldig bekennte, würde er von der Gesellschaft akzeptiert und zugleich zu ihrem Erlöser. Wer sich an den freien Frank erinnert, der eifrig die Flagge der Südstaaten hisste, weiß, wo die Quelle dieses Schulddeliriums liegt. "Er sah sich in wallendem Gewand und Sandalen in einer Wüstenszene, predigend auf einem Hügel . . . Er schloß die Augen und sah ein tiefes, verbranntes Orange - die Farbe, dachte er, des Friedens." Die Mörder treffen auf ein Opfer, das sich mit den Verfolgern identifiziert und bereit ist, seine Rolle bis zum Ende zu spielen. Der Grat, auf dem Mamets schriftstellerische Fantasie wandelt, wird hier äußerst schmal. Vor dem Abgrund eines spekulativen literarischen Missbrauchs bewahrt ihn der kurz und brutal gestaltete Lynchmord selber. Diese knappe Seite erhält ihren Schrecken auch dadurch, dass Mamet die Erlebniswelt Franks verlässt. Sein letzter Blick gilt den Mördern, die sich an ihrer Tat voyeuristisch berauschen und sie stolz für die Nachwelt festhalten. Diese Schande hat bis heute überlebt.
David Mamet: "Der Fall Leo Frank". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Bernd Samland. Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg 2000. 192 Seiten, br., 29,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
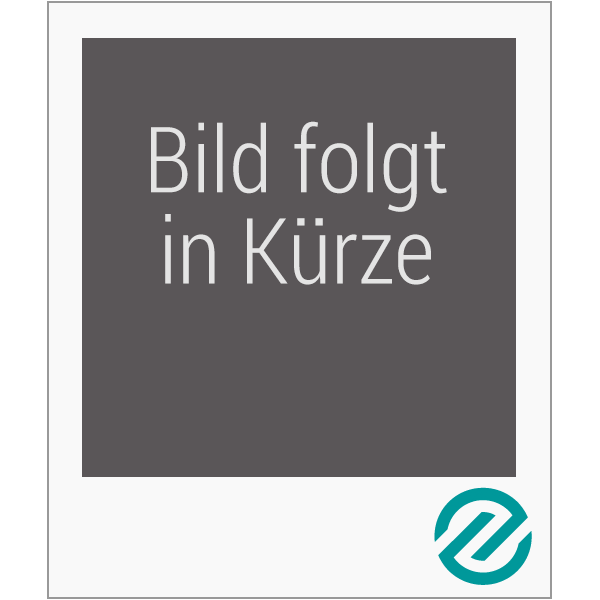




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.03.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.03.2000