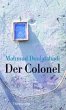Nicht lieferbar
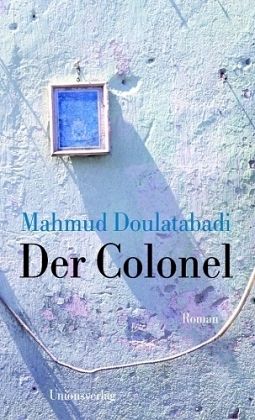
Der Colonel
Roman
Aus d. Pers. u. mit e. Nachw. v. Bahman Nirumand
Eine pechschwarze Regennacht in einer iranischen Kleinstadt, ein altes Haus. Der Colonel hängt seinen Gedanken nach. Erinnerungen stürmen auf ihn ein. An seine Jahre als hochdekorierter Offizier der Schah-Armee. An seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sich den Revolutionsgardisten Khomeinis angeschlossen haben und in den Krieg zogen, in die Leidenschaften der Revolution und des Todes. Durch die Gassen werden die gefallenen »Märtyrer« getragen, in der Stadt werden ihnen Denkmäler gebaut. Es herrscht Krieg »diese giftige, fleischfressende Pflanze«. Und im Haus sind Geheimnisse ver...
Eine pechschwarze Regennacht in einer iranischen Kleinstadt, ein altes Haus. Der Colonel hängt seinen Gedanken nach.
Erinnerungen stürmen auf ihn ein. An seine Jahre als hochdekorierter Offizier der Schah-Armee. An seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sich den Revolutionsgardisten Khomeinis angeschlossen haben und in den Krieg zogen, in die Leidenschaften der Revolution und des Todes. Durch die
Gassen werden die gefallenen »Märtyrer« getragen, in der Stadt werden ihnen Denkmäler gebaut. Es herrscht Krieg »diese giftige, fleischfressende Pflanze«. Und im Haus sind Geheimnisse verborgen: Ein Sohn versteckt sich im Keller, gepeinigt von den Albträumen seiner Erinnerungen. Da klopft es an die Tür. Der Colonel wird abgeführt, zur Staatsanwaltschaft
Erinnerungen stürmen auf ihn ein. An seine Jahre als hochdekorierter Offizier der Schah-Armee. An seine Kinder, die ihren eigenen Weg gingen, sich den Revolutionsgardisten Khomeinis angeschlossen haben und in den Krieg zogen, in die Leidenschaften der Revolution und des Todes. Durch die
Gassen werden die gefallenen »Märtyrer« getragen, in der Stadt werden ihnen Denkmäler gebaut. Es herrscht Krieg »diese giftige, fleischfressende Pflanze«. Und im Haus sind Geheimnisse verborgen: Ein Sohn versteckt sich im Keller, gepeinigt von den Albträumen seiner Erinnerungen. Da klopft es an die Tür. Der Colonel wird abgeführt, zur Staatsanwaltschaft