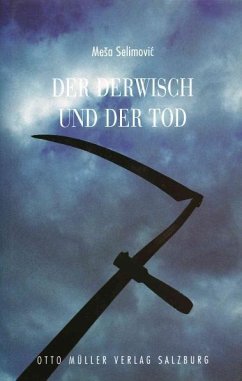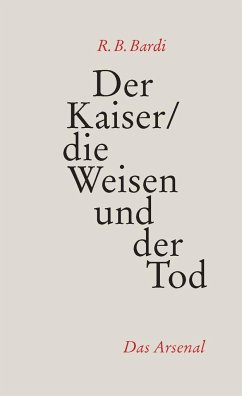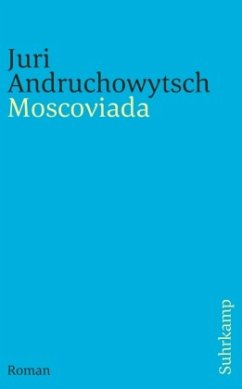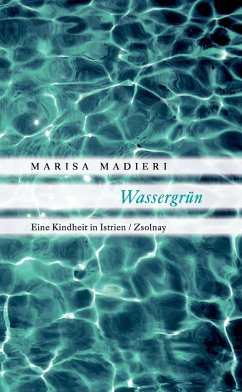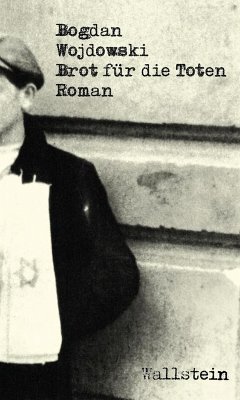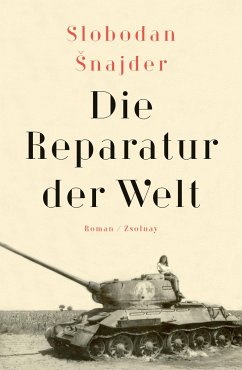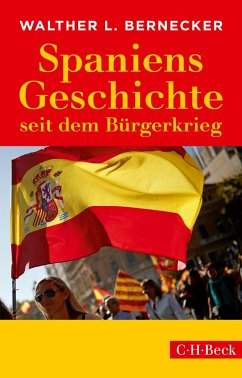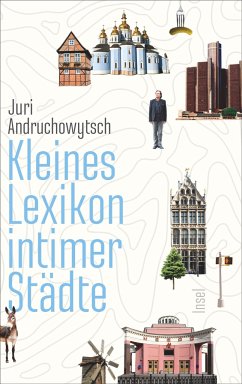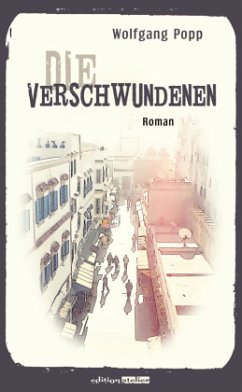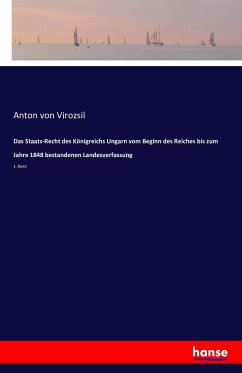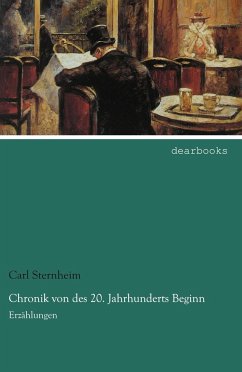einerseits die "lichte Zukunft" des Kommunismus zu evozieren, andererseits die im Sowjetstaat real existierenden Mißstände auszublenden.
Es versteht sich, daß die sowjetische Literaturproduktion, die solch spekulativem Realismus wohl oder übel verpflichtet war, keineswegs geeignet ist, die inzwischen abgeschlossene Geschichte der Sowjetunion glaubwürdig zu dokumentieren oder gar zu deren moralischer und intellektueller Bewältigung beizutragen. Dazu bieten sich seit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems zahlreiche Erinnerungswerke, Tagebücher, private Korrespondenzen und andere Zeitdokumente an, die erst nach Abschaffung der Zensur und der Erschließung staatlicher beziehungsweise geheimdienstlicher Archivbestände im Druck erscheinen konnten. Eindrücklichste Beispiele dafür sind die umfangreichen Aufzeichnungen der Schriftsteller Michail Prischwin, Jurij Olescha und Jewgenij Schwarz, die Memoiren der Kritikerin Emma Gerstein, die Tagebücher des Philosophen Jakow Druskin oder die Gespräche Wiktor Duwakins mit dem Literatur- und Kulturtheoretiker Michail Bachtin. In diesen wie in manch anderen persönlichen Zeugnissen vergleichbarer Art widerspiegelt sich die sowjetische Alltagswelt weit verläßlicher als bei den heute fast schon vergessenen Schulbuchklassikern des Sozrealismus und deren zahllosen Mitläufern.
Einen Mittelweg zwischen offizieller und inoffizieller Zeitzeugenschaft hat noch zur Stalinzeit der Prosaiker und Essayist Konstantin Paustowskij (1892 bis 1968) eingeschlagen und - massivem behördlichem Druck zum Trotz - bis an sein Lebensende mit bemerkenswertem Anstand durchgehalten. Unter dem schlichten (und gerade in seiner Schlichtheit vom Pathos der kanonisierten Sowjetbelletristik abweichenden) Titel "Erzählung vom Leben" legte er ab 1945 in lockerer Folge insgesamt sechs Bände autobiographischer Prosa vor, von denen der letzte 1963 in Moskau erschien. Die "Erzählung vom Leben", deren dritter und vierter Teil nun in einem Band der Anderen Bibliothek zusammengefaßt sind, verbindet in konventionell-gepflegter Schreibbewegung den Erfahrungsbericht des jugendlichen Autors mit der kollektiven Biographie der frühen Sowjetgesellschaft.
Nicht als eine historische Wende- oder Katastrophenzeit, auch nicht als ein Triumph menschlicher Niedertracht oder taktischen Kalküls werden die Machtergreifung der Bolschewiki und die Schrecknisse des Bürgerkriegs geschildert, sondern als ein gleichsam naturgewolltes "vertracktes Ineinander von Umständen". Dazu passen die weitgehende, bisweilen irritierende politische und emotionale Abstinenz des Ich-Erzählers, die Konzentration seiner Optik auf Einzelfälle und Nebensachen, der klare Vorrang neutraler Beobachtung gegenüber engagiertem Kommentar, nicht zuletzt auch die deutliche Neigung, historische oder zeitkritische Reflexion zu ersetzen durch metaphorische Gegenstands- oder Naturbeschreibungen.
Unter den damaligen Zensurbedingungen war aber wohl keine andere Annäherung an den real existierenden Sowjetkommunismus möglich - statt die rote Bürokratie zu kritisieren, beschreibt Paustowskij (nur ein Beispiel unter vielen sei hier angeführt) mit allen Details eine gewöhnliche bolschewistische Amtsstube: "Die Sperrholzwände, die nirgends bis zur Decke reichten, überschnitten sich unter den seltsamsten Winkeln, teilten Treppenabsätze in zwei Teile und bildeten allerlei dunkle, geheimnisvolle Übergänge, Korridorstümpfe und Ecken. - Hätte man von diesen Dienststellen mit ihren zahllosen Zwischenwänden die Dächer abdecken können, so hätte dem überraschten Zuschauer sich das Bild eines verworrenen menschlichen Ameisenhaufens geboten . . . Sie schrieben den ganzen Tag über Berge von Papieren voll und verbargen sie zur Nacht in den Sperrholzverschlägen wie in Waben oder Zellen."
Daß sich Paustowskij der offiziellen Literaturdoktrin vorsichtig und konsequent anpaßt, ist offenkundig, schlägt aber nie in Peinlichkeit um, auch dann nicht, wenn Lenin allzu schönfärberisch als großer väterlicher Aufklärer und der Anarchistenführer Machno allzu schwarzseherisch als veritabler Satan herausgestellt wird; klar ist auch, daß die Roten Garden der Bolschewiki stets gut organisiert, stets siegreich und stets menschenfreundlich auftreten, während die weißen Konterrevolutionäre grundsätzlich als brutale Schinder und Antisemiten in Erscheinung treten.
Paustowskijs Stärke kommt vorab in seinen dichten Naturbeschreibungen zum Tragen, bei der Vergegenwärtigung sonnendurchfluteter Landschaften und klirrender Winterszenen, aber auch in manchen Einzelporträts bekannter und unbekannter Zeitgenossen, etwa Isaak Babels oder Eduard Bagrizkijs, einer prallen Soldatenbraut oder einer jungen jüdischen Musikerin, die wegen fehlender Medikamente qualvoll an einer Infektion stirbt, während gleichzeitig von draußen hektischer Gefechtslärm den Bürgerkrieg ins Zimmer trägt.
Diese große "Erzählung vom Leben" setzt sich aus lauter kleinen Realitätsausschnitten zusammen, die insgesamt ein wechselhaftes, zwischen desolatem Grau und aggressivem Rot changierendes Panorama der frühen Sowjetepoche ergeben und die den Autor als einfühlsamen, wiewohl mitunter etwas kurzsichtigen und allzu optimistischen Augenzeugen ausweisen. Paustowskijs schriftstellerisches Anliegen bestand, nach seinem eigenen Bekunden, darin, "das Leben aus nächster Nähe wie durch eine Lupe zu betrachten" und ihm, ganz unprätentiös, ein bißchen "mehr Poesie zu verleihen, als es in Wirklichkeit besaß".
FELIX PHILIPP INGOLD
Konstantin Paustowskij: "Der Beginn eines verschwundenen Zeitalters". Aus dem Russischen übersetzt von Gudrun Düwel und Georg Schwarz. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2002. 524 S., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
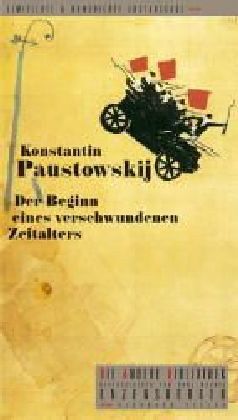




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.02.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.02.2003