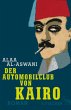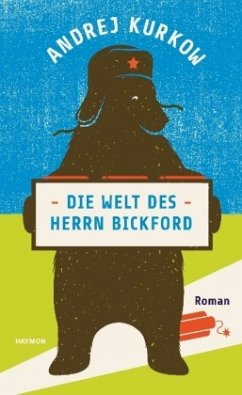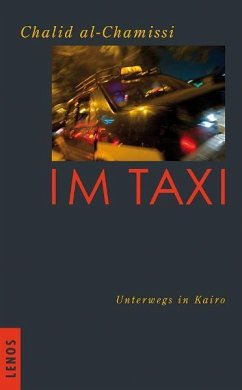Nicht lieferbar
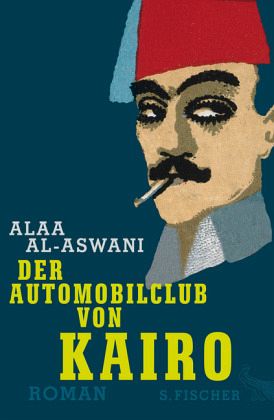
Der Automobilclub von Kairo
Roman
Übersetzung: Fähndrich, Hartmut
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Der neue Roman vom wichtigsten Autor ÄgyptensEnde der 1940er Jahre herrschen im Automobilclub von Kairo unter den surrenden Ventilatoren Extravaganz und Dekadenz: Paschas, Monarchen und Diplomaten gehen ein und aus. Auch der König zählt zu den Stammgästen, er kommt regelmäßig zum Pokerspielen und sucht die schönsten Frauen für die Nacht. Den Reichen zu Diensten steht eine Armada von schlechtbezahlten, schikanierten Dienern, Kellnern und Köchen - bis sie den Aufstand proben... In seinem Roman 'Der Automibilclub von Kairo' erzählt Alaa al-Aswani von Herrschaft und Diktatur und lässt e...
Der neue Roman vom wichtigsten Autor Ägyptens
Ende der 1940er Jahre herrschen im Automobilclub von Kairo unter den surrenden Ventilatoren Extravaganz und Dekadenz: Paschas, Monarchen und Diplomaten gehen ein und aus. Auch der König zählt zu den Stammgästen, er kommt regelmäßig zum Pokerspielen und sucht die schönsten Frauen für die Nacht. Den Reichen zu Diensten steht eine Armada von schlechtbezahlten, schikanierten Dienern, Kellnern und Köchen - bis sie den Aufstand proben... In seinem Roman 'Der Automibilclub von Kairo' erzählt Alaa al-Aswani von Herrschaft und Diktatur und lässt einen Mikrokosmos lebendig werden, der für die Zerrissenheit eines ganzen Landes, seiner Heimat Ägypten, steht.
Sprachgewaltig, nuanciert und verblüffend nah an unserer Gegenwart.
Ende der 1940er Jahre herrschen im Automobilclub von Kairo unter den surrenden Ventilatoren Extravaganz und Dekadenz: Paschas, Monarchen und Diplomaten gehen ein und aus. Auch der König zählt zu den Stammgästen, er kommt regelmäßig zum Pokerspielen und sucht die schönsten Frauen für die Nacht. Den Reichen zu Diensten steht eine Armada von schlechtbezahlten, schikanierten Dienern, Kellnern und Köchen - bis sie den Aufstand proben... In seinem Roman 'Der Automibilclub von Kairo' erzählt Alaa al-Aswani von Herrschaft und Diktatur und lässt einen Mikrokosmos lebendig werden, der für die Zerrissenheit eines ganzen Landes, seiner Heimat Ägypten, steht.
Sprachgewaltig, nuanciert und verblüffend nah an unserer Gegenwart.