sozialer Ungleichheit hervor und will damit auch "die Grundlagen unseres politischen Lebens zur Debatte" stellen. Anders als Hannah Arendt und Christian Meier erkennt er selbst im Athen des fünften und vierten Jahrhunderts vor Christus keine Autonomie der politischen Bürgerexistenz und damit des Politischen überhaupt. Die demokratische Praxis nicht allein in der institutionellen Ordnung zu erfassen ist gewiss richtig und auch keineswegs neu, doch wer stark auf die sozioökonomische Distanz abhebt, greift unweigerlich den Diskurs der antiken politischen Philosophie auf, die in der Demokratie in erster Linie eine Herrschaft der Armen über die entrechteten Wohlhabenden sah. In der Moderne wurde dieser Spieß umgedreht, die athenische Demokratie als versteckte Elitenherrschaft ausgeflaggt. Dagegen wiederum hat die Forschung gezeigt, in welchem Umfang sich Aristokraten und später reiche Politiker in Habitus und Sprechweise an die Erwartungen von "Gevatter Handschuhmacher" (Alfred Heuß) anpassen mussten, um Gehör zu finden.
Um seinen Ansatz plausibel zu machen, hätte der Autor freilich weiter ausholen müssen. Was er berichtend, räsonierend, bisweilen auch quellenkritisch ins Detail gehend darlegt, ist durchweg begründet, jedoch insgesamt zu knapp ausgefallen. Interesse verdient seine Erinnerung an weitgehend vergessene Autoren wie John Gast, Cornelius de Pauw und Friedrich Wilhelm Tittmann, die vor und nach der Französischen Revolution zu bemerkenswerten Einsichten fanden, ohne viel Gehör zu finden - eine konsistente und vor allem beachtete Verteidigung der athenischen Demokratie formulierte erst George Grote Mitte des neunzehnten Jahrhunderts.
Mit Recht hebt Giangiulio hervor, in Athen habe die politische Integration und Beteiligung breiter Schichten mit niedrigem sozioökonomischem Status diesen eine Identifikation mit der gesamten politischen Gemeinschaft ermöglicht und zu einer ganz neuen Machtstruktur geführt, deren Mitte der politische Wille aller Bürger bildete. Demokratie, so bringt er die Sache praxeologisch auf den Begriff, bestand in politischer Teilhabe und Aktivität der freien Athener. Wie das im Alltag funktionierte, muss im Detail freilich anderswo nachgelesen werden, am besten immer noch in Jochen Bleickens großer Studie von 1994. Bleicken unterstrich die Singularität Athens: Hier ergriff die seit den Reformen des Kleisthenes politisch und militärisch integrierte Bürgerschaft im Zuge einer aktiven Großmachtpolitik nach den Perserkriegen die Chance, Entscheidung und Administration selbst in die Hand zu nehmen. Tiefe Wurzeln schlug die Demokratie nur in Athen, und nur dort konnte sie die außenpolitischen Wechsellagen und Machtverluste überstehen, sogar im vierten Jahrhundert in modifizierter Gestalt stabiler dastehen als zuvor.
Schon deshalb empfiehlt es sich, sowohl für die innere Entwicklung wie für die expansive maritime Politik vor allem auf die Kontinuitäten zu den drei Generationen vor den Perserkriegen zu blicken und nicht erneut die kaum greifbaren Ereignisse um Ephialtes und den sogenannten Sturz des Areopags zum großen Umbruch zu stilisieren, wie Giangiulio es tut. Auch die gut die Hälfte des Buches ausmachenden Kapitel zu Syrakus, Kroton, Thurioi und Tarent sowie ein Exkurs zu Argos bestätigen letztlich Bleickens These: Wo eine als demokratisch etikettierte Gestalt der Regierung lediglich Produkt von Machtkämpfen, Zwangsmigrationen und militärischen Katastrophen war, währte sie meist nur kurz.
UWE WALTER
Maurizio Giangiulio: "Demokratie in der griechischen Antike". Athen, Unteritalien, Sizilien.
wbg/Philipp von Zabern Verlag,
Darmstadt 2022.
224 S., geb., 60,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
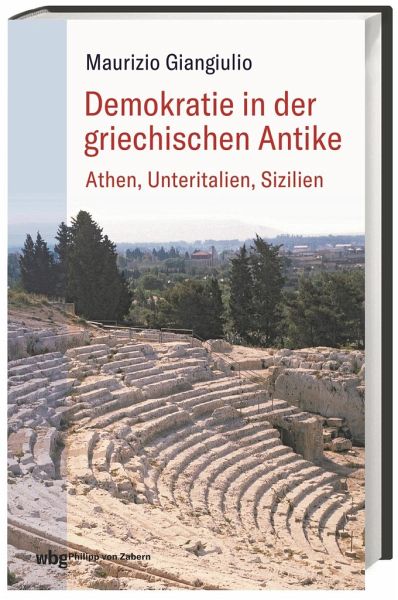







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.08.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.08.2022