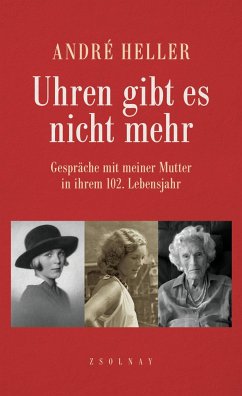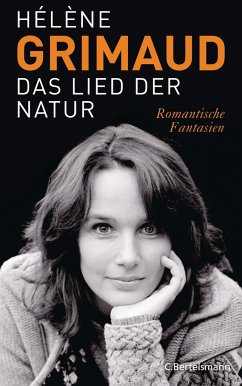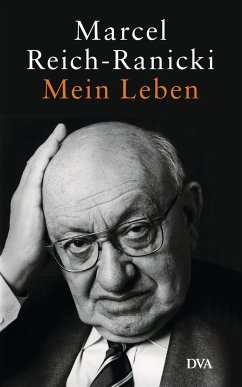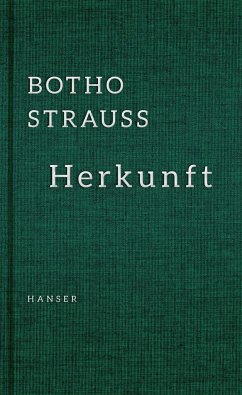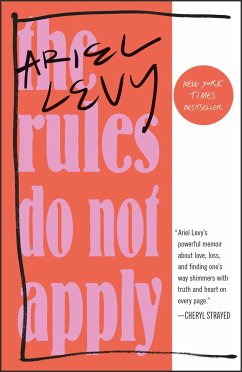bevor "er es tut. Und dann ist es das."
Emma Forrest lebt in Los Angeles. Sie interviewt Prominente, seit sie als Dreizehnjährige eine eigene Kolumne erhielt. Sie trank Kaffee mit Heath Ledger, dem jung gestorbenen Schauspieler aus "Brokeback Mountain". Und so war ein Teil der englischen Presse nach Erscheinen ihres Romans "Your Voice in My Head" 2011, wo sie das alles am Rande erzählt, ganz aus dem Häuschen. Eine Front gegen das Buch hätte von strengen Stimmen kommen können - "memory junk", Erinnerungsmüll: von Kritikern in diese Ecke gestellt zu werden, davor graute Emma Forrest. Frauen, die von Zusammenbrüchen erzählen, geschehe das leicht, wenn sie nicht gerade Zadie Smith heißen oder Jackie Collins, sagt sie in einem Interview.
Der dritte Risikofaktor für das mögliche Entgleiten dieser Geschichte über eine sehr kranke, sehr junge Frau, die Tabletten schluckt, um tot zu sein, ist der therapeutische Kontext. "Deine Stimme in meinem Kopf" ist auch ein Denkmal für jenen Therapeuten, der Emma Forrest nach ihrem ersten Selbstmordversuch acht Jahre lang begleitet. Dann stirbt er, ohne seinen Patienten etwas von der Diagnose der schweren Krankheit gesagt zu haben - er hatte mit Heilung gerechnet. Sein Tod bringt hier das Schreiben in Gang. Heute, sagt die Autorin, schaue sie mit Empathie auf dieses Mädchen, das sie nicht mehr ist. Und so will man doch wissen, warum das so ist.
Von dieser Verwandlung handelt das Buch. Und trotz aller Risiken ist es ein forsches Buch geworden, mit angenehm leichter Selbstironie verfasst. Emma Forrest erzählt, wie es trotz aller inneren Widerstände möglich ist, eine andere Haltung zu sich selbst einzunehmen; und welche Rolle "Dr. R" dabei spielt und die professionell begleitete Arbeit an sich selbst.
Die erste Hürde muss sie bewältigen, als sie nach der Todesnachricht im digitalen Kondolenzbuch liest. Andere hat er auch gerettet! Das sei, als würde man plötzlich feststellen, dass man sein Lieblingsbuch teilt. Die Einträge anderer Patienten fließen in Emmas Geschichte mit ein wie Leitplanken eines Wegs, den parallel viele gingen, Suchtkranke, Missbrauchte, der ganze Diagnosekatalog. Kurze Botschaften, die Dankbarkeit formulieren. Niemand weiß viel über "Dr. R", dieses Ungleichgewicht ist ja die Geheimwaffe jeder Therapie. Dass er am Ende des Buchs trotzdem als Mensch sichtbar ist und auch als Figur im Text so gut taugt, mag der offenbar gut funktionierenden therapeutischen Beziehung geschuldet sein. Vor allem aber Emma Forrests Sprache. Sie schreibt mit einer Gehetztheit, die etwas einfängt von dem exzessiven Mädchen, das sie damals war, neu in New York, wo ihre Verrücktheit "keinen Bezugsrahmen" hatte, "weil alle meschugge waren". Emma Forrest, 1977 in London geboren, wuchs in England auf, magnetisch angezogen vom Bild der ertrinkenden Ophelia, die sie täglich in der Tate Gallery beweinen ging, verschämt Chips futternd (und später wieder auskotzend). Da war sie dreizehn. Es dürfte egal sein, was autobiographisch ist und was hinzuerfunden. Die Geschichte dieses englisch-jüdischen Mädchens mit Kulturschock Amerika, das mit sechzehn vom Freund einer älteren Freundin beim Spazierengehen vergewaltigt wird, ist die Geschichte vieler Mädchen. Sie schweigt. Sie nimmt es nicht einmal ernst.
Und so formt sich doch ein dunkler Bezugsrahmen heraus. Der Fall Bill Clinton und Monica Lewinsky etwa, den Emma Forrest erwähnt, weil die Praktikantin im Weißen Haus gleichfalls jüdische Wurzeln hat und ohne Vorbilder war. Wie sollte sie wissen, was richtig ist? Und andere Beispiele im eigenen Leben, in denen ihr Männer die Sätze entgegenschleudern: Geh nicht schwimmen mit deinen Dehnungsfalten. Der Körper wird so zu etwas, das versteckt werden oder überschrieben werden muss. Nichts, in dem man einfach lebt und sich wohl fühlt.
Hier kommt "Dr. R" ins Spiel, der bescheidene, zugewandte Schattenspieler dieser morbid fesselnden Geschichte. Und während dieses Leben weitergeht, mit falschen Männern und einer Abtreibung, mit Streifzügen durch die Stadt, die ansteckend brodelt, mit Abstürzen, die eisklar geschildert werden, lässt Emma Forrest hin und wieder eine solche Therapiesitzung einfließen. Man geht gemeinsam ganz kleine Schritte. Kommt die Patientin mit einem neuen Bauchschnitt, sagt der Therapeut sehr sanft: Jetzt haben Sie ein Andenken. Nie würde er sagen: Jetzt sind Sie rückfällig. Das Wort "Vergewaltigungsopfer" nimmt er erst gar nicht in den Mund. Sonst würde sie daran haften. Und man merkt allmählich, was für ein Balsam hier verabreicht wird und warum das bei einer sprachaffinen Frau zu wirken beginnt. Therapie ist die Neuerzählung des eigenen Lebens, damit man sich anders dazu stellen kann.
Mit "Namedropping" begann die Autorin Emma Forrest und galt gleich als Expertin für durchgeknallte Typen und Star-Autorin. Dann kam "Thin Skin", auf Deutsch erschienen unter dem Titel "Skin" 2004, und das exzentrische "Mädchen aus dem Mittelstand" sprach plötzlich mit lockerer Zunge vom Ritzen als "neuer Magersucht" der MTV-Generation. Jetzt flicht sie die Fäden neu und ruhiger. Sie stellt sich nicht einfach aus. Sie stellt sich zur Verfügung, für die Schilderung eines Heilungsprozesses, an dessen Ende sie so gut gerüstet ist, dass sie ein Gespräch mit dem Therapeuten imaginiert. Es sind diese Phantasieräume, die zwischen den manischen Textpassagen diese lebensbedrohliche Biographie nach allen Seiten hin öffnen. Da gibt es den Rabbi, der im richtigen Moment eine Predigt hält; die Mutter mit ihren kuriosen Sätzen. Und ja, da ist auch immer wieder der anziehende Klang, den die schlimmste Krankheit haben kann, wenn man sie in Sprache verwandelt: "Depression ist ein stehendes Gewässer. Tote Dinge schwimmen darauf herum, und das Wasser ist so blauschwarz wie deine Lippen. Du verhältst dich ganz ruhig, weil das, was dein Bein streift, dir solche Angst macht (obwohl da vielleicht gar nichts ist, aber dein Verstand hat sich schon verabschiedet)."
Natürlich gibt es bereits eine Gattungsfamilie solcher Bücher. Irvin D. Yalom, der immer noch rasant schreibende Kultpsychiater, hat vorgeführt, warum Therapien auch literarisch fruchtbar sind. Hypnotisch auch die amerikanische Serie "In Treatment" mit Gabriel Byrne. Wann hat man je gesehen, dass Filme mit fast nur einem Schauplatz auskommen? Die Praxis als Hort von Geschichten und Beziehungen ist ein dramentauglicher Ort. Man kann Emma Forrests aufrichtiges Buch als Kontrapunkt dazu lesen. Auch als Hommage an alle, die diese Arbeit an sich selbst begleitet haben.
ANJA HIRSCH
Emma Forrest: "Deine Stimme in meinem Kopf". Roman.
Aus dem Englischen von Anne Braun. Deuticke Verlag, Wien 2013. 221 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
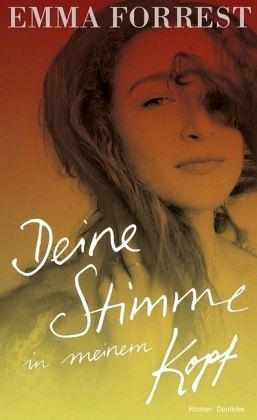





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.07.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.07.2013